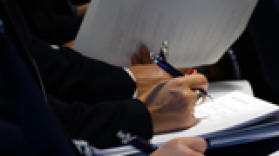Schufa: Einträge zu Privatinsolvenzen werden künftig nach sechs Monaten gelöscht
Die Auskunftei Schufa gibt dem Druck der Verbraucher und des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) nach und verkürzt die Speicherdauer für Einträge zu abgeschlossenen Privatinsolvenzen von drei Jahren auf sechs Monate. Im Vorfeld hatte am EuGH der Generalanwalt Priit Pikamäe in seinen Schlussanträgen am 16. März 2023 bereits angedeutet, dass die lange Speicherdauer von drei Jahren dem europäischen Datenschutz widerspricht (Az.: C-634/21). Der Bundesgerichtshof (BGH) setzte zeitgleich am 28. März 2023 ein entsprechendes Schufa-Verfahren aus, um die endgültige Entscheidung des EuGH in der Sache abzuwarten. Die Schufa reagierte somit auf die jüngsten juristischen Entwicklungen und erleichtert den Start für ehemalige insolvente Verbraucher zurück ins Geschäftsleben. Durch negative Schufa-Einträge haben Verbraucher oftmals Schwierigkeiten, Kreditverträge abzuschließen oder Wohnungen anzumieten. Die Kanzlei Dr. Stoll & Sauer bietet Verbrauchern mit Schufa-Problemen eine kostenlose Erstberatung im Online-Check an. Mehr Infos zum Thema Schufa gibt es auf unserer speziellen Website.
Geschäftsmodell der Schufa steht am EuGH auf der Kippe
Wer einen Kredit benötigt, eine neue Wohnung anmieten oder gar ein Haus bauen oder kaufen möchte, der wird schnell mit der Schufa konfrontiert. Banken, Telekommunikationsdienste oder Energieversorger überprüfen meist bei privaten Auskunfteien wie der Schufa die Kreditwürdigkeit einer Person. Dieses lukrative Geschäftsmodell der Auskunftei Schufa steht jetzt auf der Kippe.
Zum einen verstößt die Erstellung des sogenannten Score-Wertes für die Kreditwürdigkeit von Verbrauchern nach Ansicht eines Generalanwalts am Europäischen Gerichtshof (EuGH) gegen die europäische Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und damit gegen Europarecht. Und zum anderen stößt die Dauer der Datenspeicherung auch auf Kritik am EuGH. Die Schufa dürfe Daten aus öffentlichen Verzeichnissen - wie beispielsweise die Register der Insolvenzgerichte - nicht länger speichern als das öffentliche Verzeichnis selbst, erläuterte Generalanwalt Priit Pikamäe am 16. März 2023 in seinen Schlussanträgen (Az.: C-634/21). Mit dem Urteil wird in einigen Monaten gerechnet. Im Mittelpunkt stehen mehrere Verfahren aus Deutschland. Die Schlussanträge sind für das Gericht nicht bindend, oft folgen sie ihnen aber. Mit der Reduzierung der Speicherdauer ist jetzt die Schufa einem Urteil zuvorgekommen.
Die Kanzlei Dr. Stoll & Sauer fasst die entsprechenden Verfahren am EuGH noch einmal kurz zusammen:
Im ersten Rechtsstreit (Rechtssache C-634/21) verlangt der Kläger von der Schufa, seinen Eintrag zu löschen und ihm Zugang zu den Daten zu gewähren. Ihm war ein Kredit verwehrt worden. Die Schufa stellte sich jedoch quer, gab ihm nur seinen Score-Wert und allgemeine Informationen zur Berechnung bekannt. Daraufhin klagte der Verbraucher. Das Verwaltungsgericht (VG) Wiesbaden legte den Fall dem EuGH vor. Das VG interessiert sich besonders für die Frage, ob es sich bei dem Schufa-Scoring um eine automatisierte Verarbeitung im Sinne von Art. 22 Abs. 1 DSGVO handelt. Entscheidungen mit rechtlicher Wirkung dürfen nach dieser Norm, nicht nur durch die automatisierte Verarbeitung von Daten getroffen werden. Doch genau so verhält sich das Scoring nach Ansicht des Generalanwalts. Die automatisierte Erstellung eines Wahrscheinlichkeitswerts über die Kreditwürdigkeit stellt eine solche verbotene automatische Entscheidung dar. Dabei spielt es keine Rolle, wenn beispielsweise Banken endgültig entscheiden, ob die Person kreditwürdig sei.
Mit dem Thema Restschuldbefreiung nach einer Insolvenz beschäftigen sich zwei weitere Verfahren (Az.: C-26/22 und C-64/22). Privatleute haben die Möglichkeit, sich durch eine Verbraucherinsolvenz innerhalb eines begrenzten Zeitraums von ihren Schulden zu befreien, auch wenn sie nicht alles zurückzahlen können. Am Ende eines erfolgreichen Verfahrens steht die sogenannte Restschuldbefreiung. Alle nicht getilgten Schulden werden dabei erlassen. Die Privatinsolvenz soll Verbrauchern zum Neustart verhelfen. Daher löschen Insolvenzgerichte öffentliche Informationen über Privatinsolvenzen nach einem halben Jahr. Die Schufa löscht die Einträge in ihrem eigenen Register allerdings erst nach bis zu drei Jahren.
Das lange Aufbewahren der Daten über private Insolvenzen wertet der EuGH-Generalanwalt als rechtswidrig. Ziel der Restschuldbefreiung sei es, dass die Betreffenden sich wieder am Wirtschaftsleben beteiligen können. Das würde vereitelt, wenn private Wirtschaftsauskunfteien die Daten über die Insolvenz länger speichern dürften. Betroffene hätten deshalb das Recht, von der Schufa zu verlangen, dass die Daten unverzüglich gelöscht werden.
DSGVO stärkt Verbraucherrechte gegen Auskunftei Schufa
Bis zur Einführung der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) im Jahr 2018 konnten nach geltender Rechtsprechung Auskunfteien nach Erteilung der Restschuldbefreiung die beendete Privatinsolvenz für insgesamt drei Jahren speichern und in ihrer Bonitätsbewertung (Score) berücksichtigen. Mit Einführung der DSGVO kam neue Bewegung in die Diskussion. Denn nach Artikel 17 Abs. 1 DSGVO kann eine Löschung unter anderem dann verlangt werden, wenn die Verarbeitung nicht rechtmäßig und nach dem Verarbeitungszweck nicht mehr notwendig ist oder wegen einer besonderen persönlichen Situation. Gerade die persönliche Situation nach einer Insolvenz ist für Verbraucher heikel. Ein negativer Schufa-Eintrag, der sich auf die abgeschlossene Insolvenz bezieht, behindert in jedem Fall den vom Gesetzgeber gewollten Neustart des ehemaligen Schuldners.
Die DSGVO stärkt aus Sicht der Kanzlei Dr. Stoll & Sauer die Rechte der Verbraucher auch gegen Auskunfteien wie die Schufa. Die Kanzlei rät Verbrauchern, die Probleme mit Schufa-Angelegenheiten haben, daher zur anwaltlichen Beratung. Im kostenfreien Online-Check und der kostenlosen Erstberatung zeigen wir Möglichkeiten auf, wie Schufa-Einträge geprüft und gelöscht werden können.
Erhöhung der Pfändungsfreigrenze zum 1. Juli 2022
Verbraucherzentrale Hamburg rät dazu, korrekte Anwendung der Pfändungstabelle zu prüfen
Ab dem 1. Juli 2022 gelten neue Pfändungsfreigrenzen für das Nettoeinkommen. Die Bundesregierung erhöht die Beträge der sogenannten Pfändungstabelle. Demnach ist ein Betrag bis 1.339,99 Euro monatlich unpfändbar. Bislang betrug die Grenze 1.259,99 Euro. Für Menschen mit Unterhaltsverpflichtungen gilt ab dem 1. Juli ebenfalls ein neuer Freibetrag: Dieser steigt für die erste unterhaltberechtigte Person um 110 Euro von 1.729,99 auf 1.839,99 Euro. Mit jeder weiteren unterhaltsberechtigten Person erhöht sich der Freibetrag um 278,90 Euro.
„Die Lebenshaltungskosten sind in den letzten Wochen und Monaten noch einmal deutlich gestiegen“, so Kerstin Föller von der Verbraucherzentrale Hamburg. „Die Anpassung der Pfändungsfreigrenzen hilft den Verbraucherinnen und Verbrauchern, wenngleich sie den Verlust der Kaufkraft nur bedingt ausgleichen kann.“ Auch beim Pfändungsschutzkonto wurde der Grundfreibetrag von 1.260,00 Euro auf 1.340,00 Euro erhöht. Die Pfändungstabelle wird jährlich angepasst.
Anwendung der aktuellen Tabelle prüfen
Die Anpassung an die neuen Grenzen vollziehen Banken und Sparkassen bei Lohn- und Kontopfändungen automatisch. Es gibt keine Übergangsregelung. „Sowohl die Banken als auch die Arbeitgeber und Sozialleistungsträger sind verpflichtet, die neuen Pfändungsfreigrenzen zu berücksichtigen“, erklärt Föller. „Dennoch empfehlen wir Verbraucherinnen und Verbrauchern, sich insbesondere bei schon länger laufenden Pfändungen und Abtretungen beim Arbeitgeber oder Sozialleistungsträger zu erkundigen, ob diese tatsächlich die aktuelle Pfändungstabelle anwenden.“ Bei fehlerhaften Auszahlungen an Gläubiger nach der alten Tabelle können Schuldner die Nachzahlung der zu viel gezahlten Beträge vom Arbeitgeber, Sozialleistungsträger oder Kreditinstitut verlangen.
Individuelle Freibeträge, die per Gericht oder Vollstreckungsstelle öffentlicher Gläubiger festgesetzt werden, müssen Schuldner jedoch selbst ändern lassen. „Wenn der Schuldner also beispielsweise zusätzlich unpfändbare Lohnanteile wie z. B. Auslöse oder Fahrgeld bezieht, sollte er sich für eine Anpassung an das zuständige Amtsgericht wenden“, so Föller.
Verbraucherzentrale unterstützt Ratsuchende
Verbraucher mit Unterhaltsverpflichtungen können sich von einer anerkannten Insolvenzberatungsstelle, zum Beispiel der Verbraucherzentrale Hamburg, eine Bescheinigung zur Erhöhung des Grundfreibetrages ausstellen lassen. Die Insolvenz- und Schuldnerberatungsstelle der Verbraucherzentrale Hamburg unterstützt Ratsuchende bei Fragen rund um das Thema Schulden unter der Telefonnummer 040 /24832-109.
Sprunghafter Anstieg: Privatinsolvenzen steigen in Deutschland um 56,5 Prozent
Die Privatinsolvenzen sind in Deutschland im 1. Quartal 2021 sprunghaft angestiegen. In den ersten drei Monaten des Jahres gab es 31.821 private Insolvenzen und damit um 56,5 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum (1. Quartal 2020: 20.328). So lauten die zentralen Ergebnisse aus dem "Schuldenbarometer 1. Quartal 2021" des Informationsdienstleisters CRIFBÜRGEL.
Nach zehn Jahren sinkender Fallzahlen werden die Privatinsolvenzen 2021 wieder steigen. "Aktuell gehen wir von bis zu 110.000 Privatinsolvenzen und damit von einer Verdopplung der Zahlen in diesem Jahr aus", sagt CRIFBÜRGEL Geschäftsführer Dr. Frank Schlein. 2020 gab es insgesamt 56.324 private Insolvenzen in Deutschland.
"Der deutliche Anstieg an Insolvenzen ist derzeit vor allem darauf zurückzuführen, dass viele Privatpersonen letztes Jahr entsprechende Anträge zurückgehalten haben. Sie wollten von einer Gesetzesreform profitieren, die Betroffenen von Privatinsolvenzen künftig, statt wie bisher nach sechs, schon nach drei Jahren eine Restschuldbefreiung ermöglicht. Da diese Reform ein großer Vorteil ist, haben viele Antragssteller auf den entsprechenden Beschluss des Bundestages gewartet", erklärt Dr. Schlein.
Die Verkürzung des Restschuldbefreiungsverfahrens auf drei Jahre wird rückwirkend auch für alle Insolvenzverfahren gelten, die ab dem 1. Oktober 2020 beantragt wurden. Damit können auch diejenigen Schuldnerinnen und Schuldnern bei einem wirtschaftlichen Neuanfang unterstützt werden, die durch die Covid-19-Pandemie in die Insolvenz geraten sind.
Die unmittelbar von der Corona-Pandemie verursachte Insolvenzwelle wird dann ab dem 2. Halbjahr 2021 einsetzen und bis in das Jahr 2022 hineinreichen. Die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie sind nicht nur für Beschäftigte im Niedriglohnbereich existenzbedrohend, sondern auch im mittleren Einkommensbereich, z.B. durch Kurzarbeit, deutlich spürbar. Zudem wird die höhere Arbeitslosigkeit wieder zu mehr Privatinsolvenzen führen, da die betroffenen Verbraucher bei weiterhin hohen Kosten über weniger Geld verfügen. So bleibt den Menschen weniger Geld, um ihren Verpflichtungen wie Kreditzahlungen, Mieten oder Finanzierungen nachzukommen. Auf Dauer führt weniger Einkommen erst in die Überschuldung und dann in die Privatinsolvenz.
Die nördlichen Bundesländer sind auch im 1. Quartal 2021 stärker von Privatinsolvenzen betroffen als der Süden Deutschlands. So führt Bremen die Statistik mit 76 Privatinsolvenzen je 100.000 Einwohnern an. Es folgt Hamburg mit 57 Insolvenzfällen je 100.000 Einwohner. Der Bundesdurchschnitt lag in den ersten drei Monaten des Jahres bei 38 Privatpleiten je 100.000 Einwohner. Am wenigsten Privatinsolvenzen verzeichneten im 1. Quartal 2021 Bayern (26 Fälle je 100.000 Einwohner), Hessen (29) und Thüringen (30).
In der Statistik der absoluten Privatinsolvenzzahlen stehen Nordrhein-Westfalen (8.142), Niedersachsen (4.146) und Baden-Württemberg (3.479) an der Spitze.
Die Privatinsolvenzen sind in allen Bundesländern angestiegen. Allen voran Mecklenburg-Vorpommern (plus 86,7 Prozent), Nordrhein-Westfalen (plus 81,1 Prozent), Hamburg (plus 77,5 Prozent) und Thüringen (plus 75,3 Prozent). Einen lediglich geringen Anstieg meldet Sachsen-Anhalt (plus 0,3 Prozent).
59,1 Prozent (18.813) der Privatinsolvenzen wurden von Männern gemeldet. Auch im relativen Vergleich der Geschlechter sind die Männer führend. Auf 100.000 Männer entfielen 46 Privatinsolvenzen. Demgegenüber stehen 31 Privatpleiten je 100.000 weibliche Einwohner. Allerdings fiel der Anstieg bei den Frauen mit einem Plus von 61,2 Prozent stärker aus als bei den Männern (53,4 Prozent).
Die Privatinsolvenzen sind im 1. Quartal 2021 über alle Altersgruppen hinweg angestiegen. Die größten Zuwächse gab es vor allem in den beiden jüngsten Altersgruppen. Bei den 18-20-Jährigen mussten 83 Bürger*innen und damit 93 Prozent mehr eine Privatinsolvenz anmelden. In der Gruppe der 21-30-Jährigen stiegen die Fallzahlen um 84,9 Prozent auf 5.171 Insolvenzen (1. Quartal 2020: 2.797).
Insolvenz: In drei Jahren schuldenfrei
Seit Ende 2020 ist die Verkürzung des Verfahrens zur Restschuldbefreiung Gesetz. Damit können Einzelpersonen innerhalb von drei Jahren schuldenfrei werden. Davor war das in der Regel erst nach sechs Jahren möglich. Wie die Prozesse um Insolvenzverfahren und Restschuldbefreiung ablaufen, erklärt die Zeitschrift Finanztest in ihrer Februar-Ausgabe.
In der Corona-Pandemie sorgen sich viele Selbstständige und Privatleute um ihre finanzielle Zukunft. Durch die Einschränkungen funktionieren viele Geschäftsmodelle nicht wie gewohnt, oft gehen auch Kredite oder staatliche Hilfen zur Neige. Wenn Selbstständige oder Privatleute bereits fällige Forderungen nicht mehr bezahlen können, haben sie die Möglichkeit, einen Insolvenzantrag zu stellen.
Vor dem Insolvenzantrag können Schuldner versuchen, sich mit den Gläubigern außergerichtlich zu einigen. Für die Privatinsolvenz ist dieser Schritt verpflichtend. Findet keine Einigung statt, wird der Insolvenzantrag gestellt. Dabei gibt es für Selbstständige und Privatleute unterschiedliche Verfahren, die aber nach demselben Prinzip ablaufen. Das Verfahren zur Restschuldbefreiung läuft ab dem Insolvenzantrag und dauert seit Oktober 2020 regulär nur noch drei anstatt bisher sechs Jahre.
Finanztest rät: Menschen, die in eine finanzielle Notlage geraten sind, sollten sich frühzeitig beraten lassen. Hilfe bieten beispielsweise Schuldnerberatungsstellen von Verbraucherzentralen oder Wohlfahrtsorganisationen an. Oft sind die Angebote kostenlos.
Der Test Insolvenz findet sich in der Februar-Ausgabe der Zeitschrift Finanztest und ist online unter www.test.de/ueberschuldung abrufbar.
Privatinsolvenz: Chance für einen Neuanfang
Wie Betroffene aus der Schuldenfalle kommen
Seit dem Frühjahr verzeichnen Beratungsstellen für Schuldner eine deutlich höhere Nachfrage. Jetzt im Herbst rechnen Experten mit einer regelrechten Welle von Privatinsolvenzen. Die Bundesregierung plant aktuell, die Privatinsolvenz noch dieses Jahr zu reformieren, um Betroffenen schneller einen finanziellen Neustart zu ermöglichen. Michaela Rassat, Juristin der ERGO Rechtsschutz Leistungs-GmbH, erklärt, wie eine Privatinsolvenz abläuft.
Privatinsolvenz
Was bringt eine Privatinsolvenz?
Arbeitslosigkeit, Krankheit, eine teure Scheidung oder üppige Ratenzahlungen: Gründe für hohe Schulden gibt es viele. Eine Privatinsolvenz ist manchmal der letzte Ausweg, um ein lebenslanges Abzahlen von Schulden zu verhindern. „Wer Privatinsolvenz anmeldet, wird nach einer bestimmten Zeit von seinen Schulden befreit, auch wenn er sie nicht vollständig zurückgezahlt hat“, informiert Michaela Rassat. Anschließend kann er in ein schuldenfreies Leben starten. „Das Verfahren ist allerdings streng geregelt und an zahlreiche Voraussetzungen und Hürden geknüpft“, ergänzt die Rechtsexpertin von ERGO. Übrigens: Schulden durch Geldbußen, -strafen sowie Ordnungs- und Zwangsgelder oder aufgrund einer Straftat kann der Schuldner nicht durch eine Privatinsolvenz abbauen. Das gilt auch für hinterzogene Steuern bei einer Verurteilung wegen einer Steuerstraftat sowie für rückständigen gesetzlichen Unterhalt, den der Schuldner nicht bezahlt hat.
Vorbereitung der Privatinsolvenz: Schuldenbereinigungsplan aufstellen
Bevor Betroffene einen Antrag auf Eröffnung der Privatinsolvenz stellen können, sind mehrere Schritte nötig. „Zunächst müssen sie alle Belege für die Schulden wie beispielsweise Rechnungen sammeln, klären, wer die Gläubiger sind, sowie die Gesamthöhe der rückständigen Zahlungen ermitteln“, so Rassat. Diese Übersicht dient dazu, einen Schuldenbereinigungsplan zu entwickeln. Darin zeigt der Schuldner auf, wie er selbst von seinen Schulden loskommen möchte. Das Konzept kann zum Beispiel Vorschläge für Ratenzahlungen enthalten oder auch die Reihenfolge, in der die Gläubiger Zahlungen erhalten sollen.
Einigung mit Gläubigern suchen
Auf Basis dieses Plans kontaktiert dann der Schuldner seine Gläubiger. Von ihrer Zustimmung hängt ab, ob der Plan funktioniert. In der Realität ist das oft problematisch, weil nicht genug Einkommen vorhanden ist, um alle nötigen Zahlungen zu leisten. Für viele ist es auch eine unüberwindliche Aufgabe, den Plan überhaupt zu erarbeiten. Daher empfiehlt Rassat, sich an – oft kostenlose – anerkannte Beratungsstellen oder einen spezialisierten Rechtsanwalt zu wenden.
Antrag auf Insolvenz
Scheitert die außergerichtliche Einigung, erstellt die Beratungsstelle oder der Fachanwalt darüber eine Bescheinigung. Diese benötigt der Schuldner, um unter anderem mit dem Schuldenbereinigungsplan beim Insolvenzgericht einen Insolvenzantrag zu stellen. Den Antrag auf eine Restschuldbefreiung kann er damit gleich verbinden. Das Gericht versucht dann erneut, eine Lösung mit den Gläubigern zu finden. „Bleibt dies ohne Erfolg, leitet es das Insolvenzverfahren ein“, erklärt die ERGO Expertin.
Ablauf einer Privatinsolvenz
Das Gericht setzt für das Insolvenzverfahren einen Treuhänder ein, der das Einkommen und Vermögen des Schuldners verwaltet und damit, soweit möglich, die Forderungen der Gläubiger bedient. Jetzt beginnt für den Betroffenen die sogenannte Wohlverhaltensphase, in der er beispielsweise einer Arbeit nachgehen oder sich zumindest ernsthaft um eine bemühen und einen Teil seines Einkommens an den Treuhänder weiterleiten muss. Auch muss er dem Treuhänder sowie dem Insolvenzgericht einen Umzug oder Arbeitsplatzwechsel mitteilen. Direkte Zahlungen an Gläubiger darf er selbst nicht leisten. Diese Phase kann zwischen drei und sechs Jahre dauern, je nachdem, welchen Anteil seiner Schulden und der Verfahrenskosten der Schuldner in welchem Zeitraum begleicht. Hat der Schuldner sich an alle Vorgaben gehalten, kann das Gericht eine Restschuldbefreiung beschließen. Das heißt: Alle noch offenen Schulden werden ungültig. „Bis auf die Kosten des Insolvenzverfahrens ist der Betroffene jetzt schuldenfrei“, fasst Rassat zusammen.
Verkürzung des Verfahrens geplant
Um Betroffene zu entlasten, plant die Bundesregierung, die Dauer des Verfahrens generell auf drei Jahre zu verkürzen – und zwar ohne Bedingungen. Das geplante „Gesetz zur weiteren Verkürzung des Restschuldbefreiungsverfahrens“ soll rückwirkend zum 1. Oktober 2020 in Kraft treten. „Dann kommt es auch denjenigen zugute, die durch die Corona-Pandemie in die Insolvenz geraten sind“, kommentiert die ERGO Expertin. Die Verkürzung des Verfahrens soll für Verbraucher voraussichtlich zunächst bis 30. Juni 2025 gelten. Dann entscheidet die Bundesregierung, ob sie die Regelung beibehält. Mit dem Gesetz setzt sie eine EU-Richtlinie um.
Mehr Schutz vor Pfändungen
Die Bundesregierung hat den von der Bundesministerin der Justiz und für Verbraucherschutz vorgelegten Entwurf eines Gesetzes zur Fortentwicklung des Rechts des Pfändungsschutzkontos und zur Änderung von Vorschriften des Pfändungsschutzes beschlossen (Pfändungsschutzkonto-Fortentwicklungsgesetz – PKoFoG).
Ministerin Christine Lambrecht erklärte dazu:
„Die aktuelle Situation führt uns noch einmal deutlich vor Augen, wie schnell und unerwartet finanzielle Herausforderungen entstehen können. Neben den sozialen Sicherungssystemen ist daher ein ausgewogener Schutz vor Pfändungen unverzichtbarer Bestandteil einer solidarischen Gesellschaft. Diesen Schutz wollen wir deshalb maßvoll ausweiten und klarer regeln.“
Mit dem Gesetz soll der Pfändungsschutz von Kontoguthaben auf einem Pfändungsschutzkonto (so genanntes P-Konto) weiterentwickelt und an aktuelle gesellschaftliche Bedürfnisse angepasst werden. Der Gesetzentwurf sieht zu diesem Zweck verschiedene Maßnahmen vor:
So soll die Frist für die Übertragung von nicht verbrauchtem pfändungsfreien Guthaben von einem Monat auf drei Monate verlängert werden. Auf diese Weise können höhere Summen als bisher angespart werden. Dadurch soll Bürgerinnen und Bürgern zum Beispiel ermöglicht werden, größere Anschaffungen zu tätigen.
Vorgesehen ist außerdem die Einführung eines Schutzes von Guthaben bei Pfändung eines Gemeinschaftskontos. Jeder Berechtigte kann ein separates P-Konto errichten und von dessen Schutz profitieren.
Das Verbot der Aufrechnung und Verrechnung bei Zahlungskonten mit negativem Saldo soll gesetzlich normiert werden. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass Bürgerinnen und Bürger über Zahlungseingänge auch dann verfügen können, wenn sie ein Zahlungskonto mit negativem Saldo in ein P-Konto umwandeln.
Auch ein erleichterter Zugang des Schuldners zu Bescheinigungen für die Erhöhung des pfändungsfreien Grundfreibetrags ist vorgesehen. Eine Erhöhung des Grundfreibetrags ist zum Beispiel beim Bezug von Kindergeld möglich. Es wird nun geregelt, dass die zuständigen Stellen verpflichtet sind, eine entsprechende Bescheinigung auszustellen. Auch sieht das Gesetz vor, wie der Schutz gewährleistet wird, wenn die Bescheinigung nicht rechtzeitig erteilt wird.
Der Anpassungszeitraum für die Pfändungsfreigrenzen von Arbeitseinkommen soll von zwei Jahren auf ein Jahr verkürzt werden. Dies ermöglicht eine raschere Anpassung an die wirtschaftliche Entwicklung und trägt dadurch zu einem stärkeren Schutz bei.
Schließlich wird auch der Pfändungsschutz von Kultusgegenständen in religiösen und weltanschaulichen Zusammenhängen erweitert.
Privatinsolvenz und ihre Auswirkungen auf die Einkommensteuer
Wird eine Steuerrückerstattung erwartet, kann der Ehepartner eine Aufteilung der Erstattung beantragen, damit er nicht leer ausgeht.
Rund 80.000 Privatpersonen melden jährlich eine private Insolvenz in Deutschland an. Die Ursachen einer Überschuldung liegen nicht nur in überzogenem Konsumverhalten, sondern auch in Lebensereignissen wie Scheidung, Krankheit, Arbeitslosigkeit und gescheiterter Selbstständigkeit. Wird vom Schuldner eine Privatinsolvenz beantragt, wirkt sich das auf die Einkommensteuererklärung aus. Welche Wechselwirkungen es gibt, wird im Folgenden beschrieben.
Die Privatinsolvenz, auch Verbraucherinsolvenz genannt, ist ein Gerichtsverfahren, das die Zahlungsunfähigkeit einer Privatperson regelt und innerhalb weniger Jahre zu deren Entschuldung führt. Arbeitnehmer müssen ihr Vermögen und Einkommen über der festgelegten Pfändungsfreigrenze dazu einsetzen, ihre Schulden zu tilgen. Wird ein Insolvenzverfahren eröffnet, so wird dem Schuldner zunächst eine neue Steuernummer zugewiesen.
Insolvenzverwalter und Steuererklärung
Im Rahmen eines Insolvenzverfahrens wird für den Schuldner ein Insolvenzverwalter bestellt. Dessen Aufgabe ist es, die verfügbaren Gelder unter den Gläubigern aufzuteilen. Und er ist verpflichtet, für den Schuldner die Steuererklärung zu übernehmen. Solange das Verfahren läuft, erstellt der Insolvenzverwalter die Steuererklärung – auch rückwirkend – und reicht diese beim Finanzamt ein.
Der Schuldner kann sich aber nicht auf die faule Haut legen, er muss seinem Insolvenzverwalter alle Informationen, Daten, Dokumente und Unterlagen für die Einkommensteuer zur Verfügung stellen. Muss der Insolvenzverwalter einen Lohnsteuerhilfeverein oder Steuerberater für die Einkommensteuererklärung zu Rate ziehen, muss der Schuldner die Kosten nicht aus seiner Tasche, die den unpfändbaren Anteil seines Einkommens enthält, begleichen. Diese Kosten fließen in die Insolvenzmasse mit ein.
Kosten für den Insolvenzverwalter absetzen
Der Insolvenzverwalter selbst muss für seine Arbeit natürlich bezahlt werden. Seine Vergütung und der Ersatz seiner Auslagen können in bestimmten Fällen von der Einkommensteuer als außergewöhnliche Belastungen abgesetzt werden. Damit dies zutrifft, müssen die Kosten für den Insolvenzverwalter zwangsläufig sein. Das bedeutet, die Insolvenz darf nicht durch das Verhalten des Steuerpflichtigen mutwillig selbst herbeigeführt worden sein, sondern muss ihm zwangsläufig, z. B. durch Krankheit, Unfall oder Tod des Ehepartners, entstanden sein.
Aufteilung der Lohnsteuerklassen bei Insolvenz
Betrifft die Insolvenz nur einen Ehepartner, dann könnten die Eheleute darüber nachdenken, die Lohnsteuerklassen vor der Eröffnung des Insolvenzverfahrens zu wechseln. Der gepfändete Ehepartner könnte die Lohnsteuerklasse V nehmen, da ihm diese die größte Steuerlast beschert. Dadurch stünde weniger pfändbares Einkommen zur Verfügung, das Haushaltsbudget des Ehepaars würde sich dadurch während des Pfändungszeitraums aber verbessern.
Sofern keine sachlichen Gründe für dieses Vorgehen vorliegen, könnte es vom Insolvenzverwalter als Missbrauch gewertet werden und die Entschuldung gefährden. Sachliche Begründungen sind z. B. berechtigte Interessen des Ehepartners oder familiäre Verpflichtungen. Leben mehrere unterhaltspflichtige Kinder im Haushalt der Familie, ist die Höhe des Haushaltsbudgets für den solventen Ehegatten durchaus relevant. Ob eine Änderung der Lohnsteuerklassen gerechtfertigt ist, sollte sicherheitshalber mit dem Schuldnerberater oder Insolvenzverwalter besprochen werden.
Insolvenz und Steuerrückerstattung
Problematisch kann es werden, wenn ein Ehepartner insolvent ist und beide Ehegatten zusammen veranlagt sind. Im Falle einer Steuerrückerstattung ginge dann die gesamte Rückerstattung vom Finanzamt an den Insolvenzverwalter, der sie wiederum unter den Gläubigern aufteilt. Der nicht verschuldete Ehepartner ginge in einem solchen Fall leer aus. Daher ist es ratsam, dass der Ehepartner, der die Steuererklärung mitunterschreibt, im Vorfeld eine Aufteilung der Erstattung beim Finanzamt beantragt. So geht der Splittingvorteil nicht verloren, die Rückerstattung wird jedoch dem einzelnen Steuerpflichtigen zugewiesen.
Insolvenzverfahren natürlicher Personen bis 2017: Restschuld in 84,7 % der Fälle erlassen
Von den 142 086 im Jahr 2010 eröffneten Insolvenzverfahren natürlicher Personen in Deutschland haben die Gerichte bis zum Jahresende 2017 in 84,7 % der Fälle (120 403) die Schuldner von ihrer Restschuld befreit. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, gab es die meisten Restschuldbefreiungen bei Verbraucherinsolvenzverfahren (91 258 oder 85,9 % der insgesamt 106 291 Fälle). Darüber hinaus wurde bei 17 422 Insolvenzverfahren von ehemals selbstständig Tätigen (83,4 % der insgesamt 20 889 Fälle) und bei 11 723 Insolvenzverfahren von übrigen Schuldnern (insbesondere Einzelunternehmen; 78,6 % der insgesamt 14 906 Fälle) die Restschuldbefreiung erteilt.
Nicht gezahlte Mindestvergütung des Treuhänders häufigster Versagungsgrund
Bei 6 562 Insolvenzverfahren natürlicher Personen (4,6 % der Fälle) wurde die Restschuldbefreiung versagt. Der häufigste Grund war die nicht gezahlte Mindestvergütung des Treuhänders (5 140 Fälle). Weitere wichtige Versagungsgründe sind die Verletzung der Mitwirkungspflicht des Schuldners (738) und der Verstoß des Schuldners gegen Obliegenheiten (566).
Deckungsquote von durchschnittlich 2,0 % bei bis Ende 2017 beendeten Verfahren
Bei den Insolvenzverfahren von natürlichen Personen in Deutschland, die im Jahr 2010 eröffnet und bis Ende 2017 beendet wurden, mussten die Gläubiger auf 98,0 % ihrer Forderungen verzichten. Sie erhielten durchschnittlich nur 2,0 % ihrer Forderungen zurück. Diese Deckungsquote ergibt sich als Anteil des zur Verteilung verfügbaren Betrages (206 Millionen Euro) an den quotenberechtigten Forderungen (10,6 Milliarden Euro). Die Verluste der Gläubiger betrugen damit 10,4 Milliarden Euro.
Nicht berücksichtigt sind bei diesen Angaben Zahlungen des Schuldners, die nach Beendigung des Insolvenzverfahrens geleistet und zur Schuldentilgung bei den Gläubigern verwendet werden, solange das Restschuldbefreiungsverfahren noch nicht abgeschlossen ist. Die Entscheidung über die Erteilung der Restschuldbefreiung wird häufig erst Jahre nach der Beendigung von Insolvenzverfahren natürlicher Personen getroffen.
Bis 2017 beendete Insolvenzverfahren: Gläubiger müssen auf 96,1 % ihrer Forderungen verzichten
Bei Insolvenzverfahren in Deutschland, die im Jahr 2010 eröffnet und bis Ende 2017 beendet wurden, mussten die Gläubiger auf 96,1 % ihrer Forderungen verzichten. Sie erhielten durchschnittlich nur 3,9 % ihrer Forderungen zurück. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, ergibt sich diese Deckungsquote als Anteil des zur Verteilung verfügbaren Betrages (610 Millionen Euro) an den quotenberechtigten Forderungen der Gläubiger (15,7 Milliarden Euro). Die Verluste der Gläubiger betrugen damit 15,1 Milliarden Euro.
Deckungsquote bei Verbraucherinsolvenzen viel geringer als bei Unternehmensinsolvenzen
Bei Insolvenzverfahren von Unternehmen lag die Deckungsquote bei 6,2 %. Bei Verbraucherinsolvenzverfahren war sie mit 2,0 % deutlich geringer. Insgesamt hatten die Gläubiger bei Unternehmensinsolvenzen Verluste in Höhe von knapp 7 Milliarden Euro. Bei Verbraucherinsolvenzen summierten sich die Verluste auf rund 4,1 Milliarden Euro und bei den übrigen Insolvenzverfahren (zum Beispiel von ehemals selbstständig Tätigen) auf rund 4 Milliarden Euro.
11 827 Arbeitsplätze durch Unternehmenssanierung gesichert
Von den 23 530 im Jahr 2010 eröffneten Unternehmensinsolvenzverfahren in Deutschland wurden 19 352 Verfahren (82,2 %) bis zum Jahresende 2017 beendet. Bei 941 dieser Unternehmensinsolvenzverfahren erfolgte eine Sanierung. Dabei wurden 11 827 Arbeitsplätze gesichert. Besonders häufig gab es einen Sanierungserfolg bei Insolvenzverfahren mit hohen Forderungssummen. So konnten beispielsweise bei Verfahren mit Forderungen ab 5 Millionen Euro 23,8 % der Unternehmen saniert werden. Sehr geringen Sanierungserfolg hatten dagegen Verfahren mit niedrigen Forderungen: Nur bei 1,5 % der Unternehmen mit Forderungen unter 50 000 Euro erfolgte eine Sanierung.
Bis 2014 beendete Insolvenzverfahren: Gläubiger erhielten durchschnittlich 2,6 % ihrer Forderungen zurück
Bei Insolvenzverfahren in Deutschland (ohne Bremen), die im Jahr 2010 eröffnet und bis Ende des Jahres 2014 beendet wurden, erhielten Gläubiger durchschnittlich 2,6 % ihrer Forderungen zurück. Wie das Statistische Bundesamt nach vorläufigen Ergebnissen weiter mitteilt, ergibt sich diese Deckungsquote als Anteil des zur Verteilung verfügbaren Betrages (282 Millionen Euro) an den quotenberechtigten Forderungen der Gläubiger (10,9 Milliarden Euro). Die Verluste der Gläubiger betrugen damit 10,6 Milliarden Euro.
Bei Insolvenzverfahren von Unternehmen, die im Jahr 2010 eröffnet und bis Ende 2014 beendet wurden, lag die Deckungsquote bei 5,0 %. Bei Verbraucherinsolvenzverfahren war die Deckungsquote mit 1,6 % deutlich geringer.
Von den 151 440 im Jahr 2010 eröffneten Insolvenzverfahren in Deutschland (ohne Bremen) wurden 87,7 % bis zum Jahresende 2014 beendet. Dabei konnten von den 23 369 eröffneten Insolvenzverfahren von Unternehmen 58,7 % abgeschlossen werden. Die Verfahrensdauer bei Verbraucherinsolvenzen war deutlich kürzer: 94,5 % der 104 666 eröffneten Verfahren wurden bis Ende 2014 beendet, so das Statistische Bundesamt.