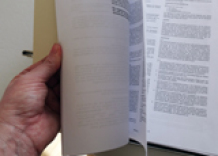Mehr als jede zweite Deckungsklage gegen Rechtsschutzversicherer erfolgreich
Verweigert die Rechtsschutzversicherung die Übernahme eines Rechtsstreits, können Kundinnen und Kunden sich wehren. Und das häufig erfolgreich, zeigt eine Untersuchung der Stiftung Warentest: Die Erfolgsquote bei den untersuchten Fällen betrug 63 Prozent. Finanztest erklärt, wie Kunden vorgehen können, wenn die Versicherung ihren Fall ablehnt.
Obwohl die Stiftung Warentest den Rechtsschutz als nützliche Police empfiehlt, weist sie darauf hin, dass diese keinen umfassenden Schutz bietet. Einige Lebensbereiche sind entweder gar nicht oder nur teilweise versichert, wie beispielsweise Streitigkeiten im Zusammenhang mit Kapitalanlagen oder Bauvorhaben. Außerdem können Versicherer einen Fall ablehnen, wenn sie keine Erfolgsaussichten sehen.
Lehnt der Rechtsschutzversicherer die Übernahme eines Falls mangels Erfolgsaussichten ab, können Kunden die Entscheidung durch einen Anwalt oder einen Schiedsgutachter überprüfen lassen. Wenn das Gutachten positiv ausfällt, ist der Versicherer in der Regel verpflichtet, den Fall zu übernehmen. Sollte er dies dennoch verweigern, kann eine Beschwerde unter versicherungsombudsmann.de eingereicht werden. Neben dieser kostenlosen Variante besteht die Option einer Deckungsklage.
Juraprofessor Christian Armbrüster hat im Auftrag der Stiftung Warentest alle veröffentlichten Deckungsklagen im Zeitraum von 2012 bis 2024 ausgewertet. Von 410 Gerichtsentscheidungen fielen 258 zugunsten der Kunden aus, was einer Erfolgsrate von rund 63 Prozent entspricht. Die Hauptstreitpunkte umfassten Fälle, die mit dem Dieselskandal in Verbindung standen, Probleme im Zusammenhang mit Ausschlussklauseln sowie die Frage nach dem bereits bestehenden Versicherungsschutz zum Zeitpunkt des Rechtsstreits. In Dieselskandal-Fällen waren Kunden mit einer Erfolgsquote von 73 Prozent besonders erfolgreich.
Weitere Informationen zum Thema finden sich in der April-Ausgabe der Zeitschrift Finanztest und unter www.test.de/rechtsschutz.
Wenn es mit dem Fahrrad gekracht hat: Rechtliche Vorschriften rund um einen Fahrradunfall
Im Straßenverkehr lauern unzählige Gefahren. Vor allem Fahrradfahrer geraten immer wieder in brenzlige Situationen. Allein im Jahr 2020 waren mehr als 100.000 Fahrradfahrer in Deutschland an einem Unfall mit Personenschaden beteiligt, also mit Toten und Verletzten. Unabhängig davon, ob es sich um solch eine dramatische Situation oder nur um einen Blechschaden handelt: Nach einem Unfall müssen Fahrradfahrer besondere Regeln beachten. Welche rechtlichen Vorschriften hier greifen, erklärt Frank Preidel, Fachanwalt für Verkehrsrecht und Partneranwalt von ROLAND Rechtsschutz.
Unfallstelle absichern, erste Hilfe leisten, Polizei informieren
Wie bei jedem anderen Unfall auch, gilt es zunächst, die Unfallstelle abzusichern, erste Hilfe zu leisten und einen Rettungswagen zu informieren. „Bei Verletzten, Streit über die Unfallursache oder einem hohen Sachschaden muss man auf jeden Fall zusätzlich die Polizei informieren“, erklärt Rechtsanwalt Frank Preidel. „Dagegen sollte man bei einem geringen Schaden die Unfallstelle unverzüglich räumen, um eine Gefahrensituation zu vermeiden.“
Dann ist es wichtig, mit den anderen Unfall-Beteiligten die persönlichen Daten auszutauschen. „Bei Autofahrern sollte man sich Name, Anschrift und das Kfz-Kennzeichen notieren. Bei anderen Fahrradfahrern müssen Name und Anschrift reichen – am besten belegt durch den Personalausweis oder ein anderes Dokument“, so Frank Preidel. Gibt es Zeugen für den Unfall, sollte man sich deren Namen und Telefonnummern aufschreiben.
Die entscheidende Frage: Wer hat Schuld?
Das weitere Vorgehen hängt davon ab, wer die Schuld am Unfall trägt. „Im besten Fall ist man sich mit den anderen Unfall-Beteiligten schnell über die Schuldfrage einig“, sagt Rechtsanwalt Frank Preidel. „Dann sollte man gemeinsam einen Unfallbericht ausfüllen, in dem die wesentlichen Daten eingetragen werden.“ Vorlagen hierfür gibt es im Internet.
Komplizierter wird es, wenn in der Schuldfrage keine Einigkeit besteht. Im Zweifel muss diese dann vor Gericht geklärt werden. „In einem solchen Fall sollte man die Polizei informieren, die dann den Unfallhergang rekonstruiert. Außerdem empfiehlt es sich, selbst Beweisfotos von der Unfallstelle zu machen, damit man diese in einem Gerichtsprozess vorzeigen kann“, erklärt Frank Preidel.
Diese Ansprüche haben Fahrradfahrer nach einem Unfall
Trägt die Gegenseite die Schuld am Unfall, kommt die Haftpflichtversicherung für Schäden des Verursachers auf. Ist man als Fahrradfahrer selber für den Unfall verantwortlich, springt die eigene Privat-Haftpflicht ein – insofern eine entsprechende Versicherung vorliegt. Denn anders als Autofahrer sind Fahrradfahrer nicht gesetzlich dazu verpflichtet, eine Haftpflichtversicherung abzuschließen. Unabhängig davon hilft nach einem Unfall auch ein Fahrrad-Schutzbrief weiter – zum Beispiel beim Abschleppen des Fahrrads nach Hause oder in eine nächstgelegene Werkstatt.
Trägt der Fahrradfahrer keine Schuld am Unfall, kann er bei der gegnerischen Haftpflichtversicherung verschiedene Ansprüche geltend machen. Hierzu zählen eine Unkostenpauschale von 20 bis 25 Euro für allgemeine Kosten, die Kosten der Reparatur oder die Kosten eines neuen Fahrrads und eine Entschädigung für den Nutzungsausfall des Fahrrads. Hierfür muss man allerdings belegen, dass man das Fahrrad regelmäßig nutzt, zum Beispiel für den Weg zur Arbeit.
„Kommt es zu einem Personenschaden, kann man außerdem Ansprüche auf Schmerzensgeld geltend machen. Hier empfiehlt es sich, einen Anwalt für Verkehrsrecht hinzuzuziehen, denn Schmerzensgeld lässt sich oft nur schwer durchsetzen“, erklärt Rechtsanwalt Frank Preidel.
Nach Brexit: Rechtsschutz für Autofahrer wichtig
Nachdem die Übergangsregelungen zwischen Großbritannien und der EU zum Jahresende 2020 ausgelaufen sind, sollten Autofahrer die Grüne Karte mitführen, wenn sie auf die Insel reisen - und darüber hinaus eine Rechtsschutzversicherung abschließen. Denn bei einem Unfall wird es komplizierter, warnt das R+V-Infocenter.
Britischer Versicherer jetzt Ansprechpartner
"Seit dem 1. Januar könnten die britischen Behörden von EU-Bürgern bei der Einreise verlangen, dass sie ihren Versicherungsschutz nachweisen", erläutert Hans-Peter Luckhaupt, Kfz-Experte bei der R+V Versicherung. Das geht einfach und unkompliziert mit der Internationalen Versicherungskarte für den Kraftverkehr, im allgemeinen Sprachgebrauch Grüne Karte genannt. Autobesitzer erhalten dieses Dokument kostenlos von ihrer Kfz-Versicherung.
Innerhalb der Europäischen Union können sich deutsche Autofahrer, die im Ausland durch ein Fahrzeug aus einem anderen EU-Land geschädigt werden, an den deutschen Repräsentanten des gegnerischen Haftpflichtversicherers wenden. "So können sie Ansprüche auf Schadensersatz schneller und einfacher geltend machen", erläutert Luckhaupt. Nach dem Brexit sieht das anders aus. Wenn Deutsche bei einer Reise nach England, Schottland, Wales oder Nordirland in einen Unfall verwickelt werden, ist ihr Ansprechpartner jetzt ausschließlich der britische Versicherer. "Dann brauchen die Autofahrer in vielen Fällen einen britischen Anwalt, der sie unterstützt. Doch das kann zeitraubend und teuer werden, vor allem wenn eine Klage notwendig ist. Eine Verkehrsrechtsschutzversicherung ist bei Reisen nach Großbritannien daher auf jeden Fall sinnvoll", rät Luckhaupt.
Bei einem Unfall mit einem britischen Fahrzeug in Deutschland ändert sich jedoch nichts: Hier besteht weiterhin die Unterstützung durch das Deutsche Büro Grüne Karte in Berlin.
Auf welche Leistungen und Bausteine Sie beim Rechtsschutz achten sollten
In vielen Lebenslagen kann es zu Streitigkeiten und Missverständnissen kommen. Ist keine Einigung in Sicht, ist oftmals der Gang zum Anwalt oder Gericht die Folge und auch sinnvoll. Mit einer Rechtsschutzversicherung können das eigene Recht abgesichert und Kosten gespart werden. Doch Rechtsschutz ist nicht gleich Rechtsschutz. Auf welche Leistungen und Bausteine es ankommt, erläutert der Rechtsschutzspezialist KS/AUXILIA.
Rechtschutzversicherung schützt in fast allen Lebenslagen
Eine Rechtsschutzversicherung ist der Grundstein für die Kostenerstattung eines juristischen Beistands. Sie hilft im privaten Bereich zum Beispiel bei Streitigkeiten in der Nachbarschaft, im Miet- und Arbeitsverhältnis, bei Verbraucherverträgen sowie hinsichtlich Schadensersatzforderungen, Steuer- und Verwaltungsangelegenheiten. Der Rechtsschutz übernimmt im Regelfall die Kosten für Anwalt, Gericht, Sachverständige, Gutachten und Zeugen. Ohne Versicherung müssten dagegen Kosten aus Rechtsstreitigkeiten eigenständig getragen werden - nicht nur, wenn man den Prozess verliert, sondern auch bei einem gerichtlichen Vergleich. Deshalb und aufgrund des hohen Zeitaufwandes sind Geschädigte oftmals abgeschreckt und verzichten darauf, ihr eigenes Recht durchzusetzen.
Tipps für die Wahl eines guten Rechtsschutzversicherers
Eine Rechtsschutzversicherung ist vorbeugend: Sie kommt in der Regel nicht für Streitigkeiten auf, die vor dem Abschluss der Versicherung und dem Ablauf der Wartezeit auftreten. Interessenten sollten sich daher so schnell wie möglich für eine Versicherung entscheiden.
Verschiedene Versicherungsvergleiche zeigen, dass die Dienstleistungen und Preise der Anbieter sehr unterschiedlich sind. Es ist weder ratsam, blind auf den günstigsten noch auf teuersten Tarif zu vertrauen. Denn häufig inkludieren die günstigsten Angebote zu wenig Leistungen. Die teuersten Angebote inkludieren in der Regel Leistungen, die vermutlich nicht gebraucht werden wie beispielsweise den Rechtsschutz für risikoreiche Kapitalanlagen, für Studienplätze oder Anliegerkosten. Testergebnisse bei verschiedenen unabhängigen Portalen geben Interessenten Sicherheit und helfen, schnell und einfach einen passenden Versicherer zu finden. Doch nicht nur gute Bewertungen zählen, erläutert Christian Deißner, Abteilungsleiter bei der KS/AUXILIA: "Die Unabhängigkeit eines Rechtsschutzversicherers ist ein wichtiges Gut. Sie kann sich insbesondere im Schadensfall positiv auswirken. Denn die Unabhängigkeit garantiert Kunden, dass beim Versicherer keine Interessenkonflikte zwischen Rechtsschutz und beispielsweise beklagter Berufsunfähigkeitsversicherung bestehen." Deißner rät Interessenten daher: "Achten Sie darauf, keine anderen Versicherungsverträge bei Ihrem Rechtsschutzanbieter zu haben. Wählen Sie idealerweise einen unabhängigen Rechtsschutzversicherer."
Auf diese Leistungen kommt es im Ernstfall an
Verbraucher sind oftmals überfordert, wenn sie sich das erste Mal mit Rechtsschutzversicherungen beschäftigen. Grund ist die Unsicherheit, wie Preis und Leistungen der einzelnen Anbieter zu gewichten sind.
Ein Kunde sollte sich auf seinen Rechtschutzversicherer verlassen können. Der Versicherer sollte schnell und leistungsstark Unterstützung gewähren. Da die Kosten für den eigenen und den gegnerischen Anwalt sowie für das Gericht bei langwierigen Prozessen sehr teuer werden, ist es empfehlenswert, beispielsweise auf eine hohe, bestenfalls unbegrenzte Deckungssumme Wert zu legen. Um weltweit auf der sicheren Seite zu sein, sollten auch Rechtsstreitigkeiten im außereuropäischen Ausland mit einer hohen Versicherungssumme abgesichert sein. Ebenfalls wertvoll sind im Ernstfall die sogenannte 5-Jahres-Regelung und der Vorsorge-Rechtsschutz: Die 5-Jahres-Regelung bedeutet, dass auch Versicherungsfälle vor Vertragsbeginn versichert sind, wenn der Vertrag mit dem betreffenden Risiko bereits seit mindestens fünf Jahren besteht. Die zweite Leistung - der Vorsorge-Rechtsschutz - bietet Versicherungsschutz für zukünftige Änderungen der Lebensumstände des Versicherungsnehmers.
Doch nicht nur in der Vergangenheit oder Zukunft lauern Gefahrenquellen. Viele Rechtsrisiken stecken im Alltag. Dazu zählt zum Beispiel das Internet: einmal unbewusst gegen das Urheberrecht verstoßen oder in eine vertragliche Auseinandersetzung bezüglich eines Online-Kaufs geraten, kann es zu einer Abmahnung bis hin zu einem strafrechtlichen Verfahren kommen. Aus diesem Grund ist es sinnvoll, sowohl auf einen Internet- als auch einen erweiterten Straf-Rechtsschutz zu achten. Dann ist man auch im Web auf der sicheren Seite.
Verkehrsrechtsschutz: Eine sinnvolle Versicherung nicht nur für Autofahrer
Eine Verkehrsrechtsschutzversicherung ist sinnvoll für alle, die am Straßenverkehr teilnehmen, also auch für Fußgänger und Radfahrer. Wer einen alten Vertrag hat, kann ihn in den meisten Fällen getrost behalten. Wer keinen hat, findet in dem neuen Test der Stiftung Warentest heraus, welche zu ihm passt. Der Schutz ist nicht teuer. Er hilft bei Streit um Blechschäden am eigenen Auto oder am Mietwagen, um Schmerzensgeld oder bei Ärger nach dem Autokauf, wenn etwa die Abgassoftware manipuliert wurde.
Die Versicherungsexperten von Finanztest haben für die Januar-Ausgabe 130 Tarife von 34 Versicherern getestet, das Kleingedruckte studiert, Beispiele für Modellfälle durchgerechnet und alles miteinander verglichen. Heraus kamen 9 sehr gute Angebote für eine Verkehrsrechtsschutzversicherung und 10 gute.
Viele konnten nicht überzeugen. Wer sich also als Verkehrsteilnehmer gegen Streitigkeiten absichern will, die mit Anwalt oder vor Gericht ausgetragen werden und sehr teuer werden können, ist gut beraten, in den vorderen Tabellenplätzen nach einer geeigneten Police zu suchen. Mit und ohne Selbstbehalt zahlt man dafür je nach Modellkunde um die 100 bis 200 Euro im Jahr.
Wer Carsharing nutzt oder oft Autos mietet, sollte darauf achten, dass auch Mietwagen inklusive sind. Bei vielen alten Verträgen ist das der Fall, weshalb die Experten raten, sich den eigenen Vertrag genau anzusehen, bevor man Hals über Kopf wechselt.
Für alle, die ganz neu abschließen wollen, gilt: Sehr gut in allen berechneten Modellfällen schnitten ADAC, Advocard, Allianz, Allrecht/Deurag, LVM, WGV und wgv-himmelblau ab.
Folgenschwere Fehler im Krankenhaus: Welche Rechte haben Patienten nach einer Falschbehandlung?
Mangelnde Hygiene, falsche Medikamente, Fehler bei der OP. Selbst im Krankenhaus passieren hin und wieder Fehler - manche von ihnen mit tragischem Ausgang. Eine aktuelle Studie zeigt: Jeder dritte Arzt macht einmal im Monat einen Behandlungsfehler. Der Hamburger Rechtsschutzversicherer Advocard erklärt, wie Patienten gegen vermeintliche Falschbehandlungen vorgehen können.
Wer sich bei einem Arzt oder einer Klinik in Behandlung begibt, der erwartet, dass es ihm anschließend besser geht. Vertrauensvoll begibt man sich in die Hände der Halbgötter in Weiß. Doch auch die machen Fehler: Operationen und Medikation sind nie ohne Risiko. Eine aktuelle Studie der Stiftung Gesundheit belegt dies. Ihr Ergebnis könnte das Vertrauen von Patienten nachhaltig stören: Von den befragten Ärzten gaben 31 Prozent an, mindestens einmal im Monat einen Fehler zu machen, der zu Patientenschäden führt.
Bei jeder Operation kann es - auch wenn sie nach allen Regeln der ärztlichen Kunst durchgeführt wird - zu Komplikationen kommen. Der Arzt haftet in solchen Fällen in der Regel nicht für Folgeschäden. Er kann aber trotzdem zur Verantwortung gezogen werden, wenn der Patient nachweisen kann, dass er vor dem Eingriff nicht ausreichend aufgeklärt worden ist. Dem Patienten müssen vor einem Eingriff alle Maßnahmen und Risiken, aber auch mögliche Alternativen aufgezeigt werden. Der Arzt muss sich auch davon überzeugen, dass der Patient seine Erläuterungen auch wirklich verstanden hat und dies schriftlich dokumentieren. Nur dann ist die schriftliche Einwilligung des Patienten gültig und der Arzt darf die Operation vornehmen. Klärt der Arzt den Patienten nicht ausreichend über mögliche Folgen einer Behandlung auf, macht er sich eventuell sogar der Körperverletzung schuldig. In einem solchen Fall steht dem Patienten Schadenersatz zu.
Nicht jede Unzufriedenheit ist Grund zur Klage
Wann ein ärztlicher Kunstfehler vorliegt und wann nicht, lässt sich erst durch eine sorgfältige Prüfung des Einzelfalles feststellen. Nur wenn konkrete Verstöße des Arztes gegen allgemeine Richtlinien und Qualitätsstandards nachgewiesen werden, hat der Patient das Recht auf Schadenersatz. Advocard Rechtsexpertin Anja-Mareen Decker erläutert: "Unzufriedenheit des Patienten mit dem Ergebnis einer Behandlung ist noch kein Grund für eine Schmerzensgeldforderung. Das gilt besonders bei kosmetischen Operationen - vorausgesetzt der Arzt hat den Patienten vorab ausreichend aufgeklärt." In diesem Sinne hat auch das Landgericht Osnabrück entschieden (Az: 2 O 1303/03): Die Richter wiesen die Schadenersatzklage einer Patientin ab, die mit dem Ergebnis einer Brustkorrektur nicht zufrieden war. Die Begründung: Dem Chirurgen waren weder ein konkreter Behandlungsfehler noch mangelnde Aufklärung nachzuweisen.
Wie kommen Patienten zu ihrem Recht?
Sollten Patienten eine fehlerhafte ärztliche Behandlung vermuten, stehen ihnen verschiedene Wege zur Verfügung. Für eine unabhängige Begutachtung durch einen neutralen Fachmann haben die Landesärztekammern Schlichtungsstellen für Arzthaftungsfragen eingerichtet. Ein solches Gutachten ist für den Patienten zudem kostenlos. Im Falle eines eindeutig nachweisbaren Behandlungsfehlers rät Anja-Mareen Decker, zuerst eine gütliche Einigung mit dem behandelnden Arzt zu suchen: "Oft ergibt sich auch ohne gerichtliches Verfahren bereits ein akzeptables Angebot für einen Ausgleich des erlittenen Schadens. Sollte das nicht der Fall sein, ist eine Schmerzensgeldklage eine mögliche Alternative." Zur Beurteilung der Erfolgsaussichten sollte gerade in diesen Fällen aber unbedingt ein spezialisierter Rechtsanwalt konsultiert werden.