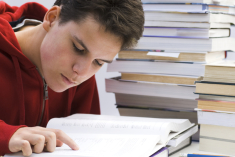Nicht krankenversichert wegen zu hoher Beiträge – was tun?
In Deutschland gilt eine allgemeine Krankenversicherungspflicht. Wer seinen Wohnsitz in Deutschland hat, muss daher entweder eine gesetzliche (GKV) oder eine private Krankenversicherung (PKV) haben. Dennoch haben nicht alle Bürger*innen eine Krankenversicherung abgeschlossen, wie jüngst in den Medien beispielsweise über den Schauspieler Heinz Hönig zu lesen war. „Insbesondere für Selbständige oder freiberuflich tätige Menschen können die Krankenversicherungsbeiträge aufgrund unregelmäßiger oder schwankender Einkommen unbezahlbar werden. Wer seine PKV-Beiträge dann nicht mehr zahlen kann, sollte auf jeden Fall das Gespräch mit dem Versicherer suchen und seinen Tarif umstellen“, rät Bianca Boss, Vorständin beim Bund der Versicherten e. V. (BdV). Der Versicherer darf auch bei Zahlungsrückständen dem Versicherten aufgrund der Versicherungspflicht nicht kündigen.
Während die Krankenkassenbeiträge in der GKV von der Höhe des Erwerbseinkommens abhängen, richten sich die Prämien der PKV nach den versicherten Leistungen, dem Alter und dem Gesundheitszustand. Kostensteigerungen werden von der PKV durch regelmäßige Erhöhungen der Prämien und/oder Selbstbehalte an ihre Versicherten weitergegeben.
Diese Optionen haben PKV-Versicherte
Der Basistarif kann sich für PKV-Versicherte anbieten, die hilfebedürftig im Sinne des Sozialrechts sind. Ihre Prämie reduziert sich dann auf die Hälfte des GKV-Höchstbeitrags. Können Versicherte auch die reduzierte Prämie nicht zahlen, übernimmt der zuständige Träger (Bundesagentur für Arbeit oder Sozialamt) einen weiteren Anteil oder sogar die komplette Prämie. Mit einem Wechsel in den Basistarif des eigenen PKV-Versicherers haben PKV-Versicherte ein Leistungsangebot, das mit jenem der GKV in Art, Umfang und Höhe weitgehend vergleichbar ist. Basistarifversicherte leisten die gleichen Zuzahlungen wie gesetzlich Versicherte. Sie können sich nur von Ärztinnen und Ärzten sowie Zahnärztinnen und Zahnärzten behandeln lassen, die eine kassen(zahn)ärztliche Zulassung haben. Möglich ist jederzeit ein Wechsel in den Basistarif desselben Unternehmens.Versicherte, die schon vor 2009 in der PKV versichert waren, können dagegen beispielsweise nur bei Hilfebedürftigkeit im Sinne des Sozialrechts in diesen wechseln.
Der leistungsschwächere Standardtarif steht nur langjährigen und älteren Versicherten offen, die vor dem 1. Januar 2009 in die PKV gewechselt sind und weitere Voraussetzungen erfüllen, wenn sie einen prämiengünstigen Tarif benötigen. Er kann dann eine Option sein, wenn Versicherten
ein Wechsel in andere normale Tarife des Versicherers nicht genügend Entlastung bringt,
die Prämie für den leistungsstärkeren Basistarif zu hoch ist,
und sie eine Leistungsreduzierung in Kauf nehmen.
Auch hier ist eine staatliche Bezuschussung – bei Hilfebedürftigkeit – möglich.
Gut zu wissen: Bevor man einen Wechsel in den Basis- oder Standardtarif vornimmt, sollte man prüfen: Ist der Verbleib oder Wechsel in andere normale Tarife des eigenen Krankenversicherers eine geeignete Lösung, da diese oftmals leistungsumfänglicher sind. Wer hilfebedürftig im Sinne des Sozialrechts ist, kann dabei grundsätzlich auch zu diesen PKV-Tarifen eine staatliche Bezuschussung bekommen.
Daher sollte man sich vor einem solchen Schritt neutral und unabhängig beraten lassen.
Wer als privat krankenversicherte Person über mehrere Monate die Prämie nicht zahlt, kann vom Versicherer bei Vorliegen bestimmter Voraussetzungen in den Notlagentarif umgestellt werden. Der Notlagentarif erstattet nur die Behandlungskosten bei akuten Erkrankungen und Schmerzzuständen, bei Schwangerschaft und Mutterschaft. Für Kinder und Jugendliche werden die Kosten medizinisch notwendiger Heilbehandlungen wegen Krankheit oder Unfallfolgen sowie von Vorsorgeuntersuchungen und Schutzimpfungen erstattet. Die Prämie liegt durchschnittlich bei ca. 135 Euro im Monat (PKV-Verband, April 2024). Während der Versicherung im Notlagentarif entfallen Selbstbeteiligung, Risikozuschläge und Leistungsausschlüsse. Zudem kann der Versicherer verlangen, dass Zusatzversicherungen, wie z. B. eine Krankentagegeld- oder eine Kurtagegeldversicherung, ruhen.
Wichtig zu wissen: Eine Umstellung in den Notlagentarif erfolgt jedoch nicht, wenn eine Hilfebedürftigkeit im Sinne des Sozialrechts besteht. Hilfebedürftige können dann in den Basistarif wechseln – ggf. sogar gänzlich kostenfrei.
Krank im Urlaub: So viel kostet ein Rücktransport nach Deutschland
Wer ins Ausland verreist, sollte auf alle Fälle eine private Auslandskrankenversicherung im Gepäck haben. Sie deckt weltweit Krankheitskosten ab, gesetzliche Krankenkassen leisten allenfalls bei Reisen innerhalb Europas. Ein Krankenrücktransport nach Deutschland, der nach Rücksprache mit dem behandelnden Arzt medizinisch sinnvoll und vertretbar ist, ist generell nicht über die gesetzliche Krankenkasse abgedeckt - unabhängig vom Urlaubsland.
Bei medizinischen Behandlungen im Ausland können schnell Kosten von mehreren Tausend Euro fällig werden. Richtig teuer wird es, wenn ein Patient aus dem Urlaubsland mit einem der Ambulanzflugzeuge des ADAC zurück nach Deutschland geflogen werden muss.
So schlägt ein Intensivtransport aus Australien oder Neuseeland mittlerweile mit 350.000 Euro, aus Nord- und Südamerika mit 180.000 Euro und von den Kanarischen Inseln mit 60.000 Euro zu Buche. Aber auch ein bodengebundener Transport im Krankenwagen aus einem der Nachbarländer belastet die Urlaubskasse über die Massen. So kostet ein Rettungstransport mit Arztbegleitung aus St. Moritz in der Schweiz nach München 2.450 Euro. Die Kosten für einen Auslandskrankenschutz nehmen sich angesichts dessen gering aus.
63 mal um die Welt: 2,54 Millionen Flug-Kilometer zurückgelegt
Der ADAC Ambulanz-Service hat 2023 insgesamt 47.473 verletzen und kranken Urlaubern geholfen, für 10.286 organisierte er einen Krankenrücktransport in eine Klinik in der Heimat.
Hauptursachen für die Krankenrücktransporte waren in knapp 60 Prozent der Fälle Verletzungen, 16 Prozent gingen auf Herz-Kreislauf Erkrankungen und acht Prozent auf Schlaganfälle zurück. Die restlichen Diagnosen teilen sich auf in Bandscheibenprobleme, Lungenerkrankungen, Infektionen, urologische und gynäkologische oder neurologische Erkrankungen. Die Jets im Auftrag des ADAC legten im Jahr 2023 insgesamt 1,37 Millionen nautische Meilen, bzw. 2,54 Millionen Kilometer zurück. Das entspricht etwa 63 Weltumrundungen und rund 3. 600 Flugstunden.
Auch bei kurzem Ausflug über die Grenze Versicherungsschutz nicht vergessen
Auch bei einem kurzen Ausflug über die Grenze ins benachbarte Ausland sollte man unbedingt an den Abschluss einer Auslandskrankenversicherung denken. Denn bei einem Unfall oder plötzlicher Krankheit ist man nicht in allen Fällen über die gesetzliche Krankenkasse abgesichert. Wenn beispielsweise Wanderer oder Skifahrer in unwegsamem Gelände oder gar aus einer Gletscherspalte geborgen werden müssen, braucht man diese Versicherung, um nicht auf den Kosten sitzen zu bleiben. Beim ADAC Auslandskrankenschutz sind Bergungskosten bis zu einer Höhe von 10.000 Euro abgesichert.
Krankheitskosten mit der Steuererklärung absetzen
Medikamente Steuer absetzen - Freiverkäufliche Medikamente sind mit Rezept absetzbar
Die Virensaison ist zurück. Die Tage werden kälter und viele Menschen für Krankheiten anfälliger. In den Klassenzimmern der Schulen wird durch die Bank geschnieft und gehustet. Doch Halstabletten, Nasenspray und Aspirin werden als frei verkäufliche Medizin in der Regel nicht von den Krankenkassen bezahlt. Sitzen bleiben müssen Steuerzahlende auf den Kosten nicht unbedingt. Waren die Ausgaben in einem Jahr hoch genug, so lassen sie sich doch steuerlich absetzen.
Da die Summe der Ausgaben erst zum Jahresende feststeht, rät Tobias Gerauer, Vorstand der Lohi, sich ganzjährig bei Bedarf eine ärztliche Verschreibung einzuholen und alle Kassenbelege konsequent zu sammeln, damit später Nachweise für das Finanzamt vorhanden sind.
Ohne Rezept geht es nicht
Für die Anerkennung der Ausgaben ist eine einfache Verordnung eines Arztes oder Heilpraktikers erforderlich. Dies betrifft auch Nahrungsergänzungsmittel, die als Arzneimittel zugelassen sind. Ein Kassenbeleg von der Apotheke reicht dem Finanzamt nicht aus. Für nicht verschreibungspflichtige Medikamente lässt man das grüne Rezept einfach in der Apotheke beim Kauf abstempeln. Das war’s. Nicht erstattete Rechnungen über Behandlungen beim Arzt oder Heilpraktiker, z.B. für eine professionelle Zahnreinigung, werden grundsätzlich akzeptiert. Nur in manchen Fällen, wie z.B. einem Kuraufenthalt oder einer wissenschaftlich nicht anerkannten Behandlungsmethode wird eine Bescheinigung des Medizinischen Dienstes der Krankenkassen oder ein amtsärztliches Attest vom Gesundheitsamt benötigt.
Der steuerliche Selbstbehalt
Tipp Nummer zwei von Tobias Gerauer lautet: „Damit sich die Kosten in der Steuererklärung auswirken, sollten die Ausgaben in einem Jahr gehäuft werden.“ Denn je höher die Summe für Gesundheitsausgaben im Kalenderjahr ausfällt, desto leichter wird die individuelle Zumutbarkeitsgrenze überschritten und desto mehr springt steuerlich heraus. Diese zumutbare Eigenbelastung wird vom Finanzamt festgesetzt und hängt von der Veranlagungsart, der Kinderzahl im Haushalt und der Einkommenshöhe ab. Sie liegt zwischen ein und sieben Prozent des Gesamtbetrages der Einkünfte. Erst wenn dieser Wert überschritten wird, wirken sich die darüberliegenden Ausgaben als außergewöhnliche Belastungen steuermindernd aus.
Die Palette des Absetzbaren
Weitreichende Ausgaben zur Linderung oder Heilung einer Krankheit zählen zu den außergewöhnlichen Belastungen. Kurz ausgedrückt, alle Kosten oder Zuzahlungen für Medikamente, Heil- und Hilfsmittel, wie Schienen oder Krücken, sowie Therapien, medizinische oder physiotherapeutische Behandlungen, Honorare für Ärzte und Heilpraktiker, über Fahrtkosten bis zum Kuraufenthalt. Auch Treppenlifte, Badewannen oder Umbauten in der Wohnung können bei bestimmten Gegebenheiten abgesetzt werden.
Beliebte Klassiker bei Steuerzahlenden sind Brillen, Kontaktlinsen, Augen-Laser-Behandlungen, Hörgeräte, zahnmedizinische Behandlungen, Implantate, orthopädischen Einlagen und Rollatoren. In so gut wie jedem Haushalt finden sich Gesundheitsausgaben. Bei Kuraufenthalten kommen häufig eine Kurtaxe, Unterbringungskosten und Kosten für die Verpflegung dazu. Letztere werden mit Verpflegungspauschalen abzüglich der Haushaltsersparnis berücksichtigt.
Die eigenen Fahrtkosten zu Praxen, Kliniken, Apotheken, Sanitätshäusern oder Therapieeinrichtungen werden bei der Nutzung des eigenen PKWs mit 30 Cent je gefahrenem Kilometer berücksichtigt. Hierfür sind jedoch Aufzeichnungen über die Termine und Fahrtziele notwendig. Für die Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder dem Taxi sind Quittungen und Tickets aufzuheben. Auch Parkkosten können abgesetzt werden, wenn die Parktickets samt Quittungen noch vorhanden sind.
Richtig absetzen – wie geht das?
Zahlungen und Zuschüsse von Krankenkassen, Zusatzversicherungen oder der Rentenversicherung sind bei der Kostenaufstellung für das Finanzamt in Abzug zu bringen, denn was nicht selbst finanziert wurde, darf nicht geltend gemacht werden. Die eigens getragenen Kosten sind nur für das Kalenderjahr, in dem die Zahlung getätigt wurde, steuerlich relevant. Daher macht es Sinn, in dem Jahr, indem das Budget schon stark belastet ist, weitere Ausgaben zu tätigen. Ganz konkret heißt das, wenn z.B. kürzlich die Zähne saniert wurden, dann sollte bei Bedarf gleich die neue Gleitsichtbrille angeschafft und der Medikamentenschrank - mit Rezept versteht sich – auf Vorrat befüllt werden, so die Lohnsteuerhilfe Bayern.
Kosten für Fettabsaugung von der Steuer absetzen
Menschen, die an einer krankhaften Störung der Fettverteilung leiden (Lipödem), können rückwirkend ab dem Jahr 2016 die Kosten für eine Fettabsaugung als außergewöhnliche Belastung von der Steuer absetzen - ohne Vorlage eines amtsärztlichen Gutachtens. Das entschied kürzlich der Bundesfinanzhof (BFH). Der Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH) erklärt die Details.
Der Fall
Eine Patientin litt seit Jahren an einem Lipödem. Eine auf Lipödem spezialisierte, privatärztliche Praxis bescheinigte, dass die Erkrankung nur durch Fettabsaugung zu lindern sei. Die Krankenkasse weigerte sich aber, die Kosten der drei folgenden Liposuktionsbehandlungen zu übernehmen. Begründung: Der Gemeinsame Bundesausschuss der Krankenkassen (GBA) hatte trotz jahrelanger Prüfung noch keine entsprechende Kostenübernahmeempfehlung ausgesprochen.
Auch das zuständige Finanzamt lehnte die Anerkennung der Operationskosten als außergewöhnliche Belastung ab. Begründung: Es handele sich um eine wissenschaftlich nicht anerkannte Behandlungsmethode. Außerdem habe die Patientin versäumt, vor der Behandlung ein amtsärztliches Gutachten oder eine ärztliche Bescheinigung des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung (MDK) vorzulegen.
Die Patientin klagte, und das zuständige Finanzgericht gab der Klage statt. Denn nach Auffassung des Finanzgerichts habe sich der Stand der Wissenschaft inzwischen gewandelt, und die Behandlungsmethode Liposuktion sei als wissenschaftliche Behandlungsmethode anzuerkennen.
Die Entscheidung
Der BFH bestätigt die Auffassung des Finanzgerichts und stellt ebenfalls fest: Die Liposuktion sei nach heutigem Wissenstand als wissenschaftlich anerkannte Behandlungsmethode anzusehen. Das zuständige Finanzgericht habe nachgewiesen, dass sowohl die Bundesärztekammer wie auch nahezu alle medizinischen Lipödem-Fachgesellschaften in 2015/2016 der Auffassung waren, bei einem Lipödem habe eine Liposuktion in den meisten Fällen symptomlindernde Wirkungen. Ein formalisierter Nachweis durch ein ärztliches Gutachten oder eine Bescheinigung eines Medizinischen Dienstes der Krankenkassen ist daher seit 2016 nicht erforderlich (BFH-Urteil vom 23. März 2023, Aktenzeichen VI R 39/20, veröffentlicht am 29. Juni 2023).
Konkret heißt das für Betroffene: Wenn die Liposuktion beispielsweise im Jahr 2021 durchgeführt und die Steuererklärung noch nicht abgegeben wurde, können die Operationskosten als außergewöhnliche Belastungen angegeben werden. War die Liposuktion allerdings zum Beispiel im Jahr 2017 und der Steuerbescheid für 2017 wurde bereits erlassen, dann kann der Bescheid aufgrund des Urteils nicht mehr geändert werden - außer er wurde durch einen Einspruch offengehalten.
Übrigens: Mit seiner Entscheidung korrigierte der BFH seine Beurteilung aus dem Jahr 2010. Damals bestätigte Deutschlands höchstes Steuergericht noch die Auffassung eines Finanzgerichts, wonach Liposuktion keine wissenschaftlich anerkannte Methode sei.
Krankheitskosten und Steuern: Das können Versicherte absetzen
Der Wirtschaftswissenschaftler Bernd Raffelhüschen fordert: Gesetzlich Krankenversicherte sollen bis zu 2.000 Euro im Jahr Selbstbeteiligung zahlen. Nach aktueller Rechtslage gilt: Was die Krankenkasse oder eine Zusatzkrankenversicherung nicht zahlt, lässt sich teilweise von der Steuer absetzen. Der Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH) zeigt, worauf es ankommt.
Krankheitskosten und Steuern: Das können Versicherte absetzen
Für 2023 wird in der Gesetzlichen Krankenversicherung ein Defizit von 17 Milliarden Euro erwartet – laut Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) ist das ein historisches Ausmaß. Deshalb spricht sich der Wirtschaftswissenschaftler Bernd Raffelhüschen dafür aus, dass gesetzlich Krankenversicherte pro Jahr gestaffelt bis zu 2.000 Euro Selbstbeteiligung zahlen.
"Wir können uns das System nicht mehr leisten. Patienten müssen künftig mehr aus eigener Tasche dazu bezahlen", sagte der Professor an der Universität Freiburg der "Bild"-Zeitung (22. Februar 2023).
Raffelhüschen fordert außerdem, dass Versicherte Verletzungen nach selbst gewählten Risiken – wie beispielsweise Skifahren – komplett selbst bezahlen sollten. Auch Raucher müssten sich an den Folgekosten von Behandlungen stärker selbst beteiligen, verlangt er.
Krankheitskosten: Was Sie wie von der Steuer absetzen können
Nach aktuellem Steuerrecht gilt: Unmittelbare Krankheitskosten, die von der Krankenkasse nicht übernommen werden, lassen sich als außergewöhnliche Belastungen von der Steuer absetzen. Dazu zählen Ausgaben oder auch Zuzahlungen für
Arztbesuche
Bewegungstherapien
Brille oder Kontaktlinsen
Geburt eines Kindes
Haarausfall oder ein Toupet
Homöopathie
Impfungen
Krankengymnastik
Logopädische Behandlungen
Künstliche Befruchtungen
Zahnarztbehandlungen
Zahnspange
Verschrieben Medikamente, wie beispielsweise Antidepressiva oder Antiallergika
Aber Achtung: Das Finanzamt erkennt nur unmittelbare Krankheitskosten an. Das sind Krankheitskosten oder Gesundheitskosten, die Patienten für die Heilung einer Krankheit oder die Linderung ihrer Folgen entstehen. Ausgaben für eine Krankheitsvorbeugung können in der Regel nicht abgesetzt werden.
Medizinische Heilbehandlung muss zwangsläufig sein
Ob Ärztin oder Heilpraktiker – ist die behandelnde Person zur Heilbehandlung zugelassen, erkennen die Finanzbeamten die Kosten als außergewöhnliche Belastung an. Wichtig: Die Heilbehandlung muss gezielt angeordnet worden sein. Ist das der Fall, können die Krankheitskosten in die Anlage Außergewöhnliche Belastungen eingetragen werden.
Das gilt bei Suchterkrankungen
Wer unter Alkoholabhängigkeit, Drogensucht oder Spielsucht leidet, kann die Genesungskosten absetzen. Denn Suchterkrankungen gelten als reguläre Erkrankungen. Das gilt auch für die Raucherentwöhnung. Das heißt: Hat eine Raucherin oder ein Raucher eine ärztliche Verordnung, können sogar die Kosten für Nikotinpflaster als Krankheitskosten in die Steuererklärung eingetragen werden.
Kürzung um die "zumutbare Belastung"
Für Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, die außergewöhnliche Belastungen in ihrer Steuererklärung eintragen, gilt: Das Finanzamt rechnet eine zumutbare Eigenbelastung an. Berücksichtigt werden dabei die Höhe ihrer Jahreseinkünfte, der Familienstand und die Anzahl der Kinder.
Dementsprechend liegt die Belastungsgrenze zwischen einem und sieben Prozent. Bei einem Paar mit zwei Kindern und Einkünften von 50.000 Euro im Jahr sind es für das Jahr 2022 zum Beispiel rund 1.350 Euro. Das heißt: Bis zu dieser Grenze sind die Kosten nicht absetzbar. Aber jeder Euro, der über dieser Grenze liegt, kann von der Steuer abgesetzt werden, so der VLH.
Medizinische Gründe: Fast alle Kinder brauchen eine Zahnspange
Schiefe Kiefer sind ganz normal – für 97,5 Prozent der Acht- und Neunjährigen sind Zahnspangen medizinisch notwendig. Das zeigt das erste Modul der Sechsten Deutschen Mundgesundheitsstudie vom Institut der Deutschen Zahnärzte. Was die Krankenkassen nicht übernehmen, wird für Eltern teuer. Eine Zusatzversicherung hilft. Die DEVK zahlt auch für unsichtbare Zahnspangen.
Wie glänzende, ebenmäßige Perlen auf einer Kette – so sollten Zähne aussehen. Damit jedes Lächeln ein schönes Gebiss präsentiert, sind jedoch meist kieferorthopädische Behandlungen nötig. Wie wichtig sie sind, belegt der 2022 veröffentlichte erste Teil der Mundgesundheitsstudie. Das Forschungsprojekt ist die einzige bundesweit repräsentative Untersuchung zu Zahn- und Kieferfehlstellungen bei Kindern und Jugendlichen und die umfassendste seit 30 Jahren. Daran mitgewirkt haben neben dem Institut der Deutschen Zahnärzte auch die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung, die Bundeszahnärztekammer und die Deutsche Gesellschaft für Kieferorthopädie.
Zahn-Studie erfasst Fehlstellungen
Zahnärztinnen und Zahnärzte haben dabei mehr als 700 Acht- und Neunjährigen auf den Zahn gefühlt. Ergebnis: Bei gut 40 Prozent sind die Fehlstellungen so ausgeprägt, dass die Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) die Kosten für die übliche Korrektur übernimmt. Sie fallen in die sogenannten kieferorthopädischen Indikationsgruppen (KIG) 3 bis 5. Demnach leiden 10 Prozent der Kinder unter ausgeprägten Zahnfehlstellungen (KIG 3), über 25 Prozent unter starken (KIG 4) und 5 Prozent sogar unter extrem starken Kieferproblemen.
Viele bekommen kein Geld von der Kasse
Und was ist mit leichten Zahnfehlstellungen? KIG-Grad 2 ist am weitesten verbreitet: Bei 57 Prozent der untersuchten Mädchen und Jungen gibt es medizinische Gründe für eine kieferorthopädische Regulierung. Allerdings übernehmen die Krankenkassen hier keine Kosten. Insgesamt kommt die Mundgesundheitsstudie zu dem Ergebnis: "Der Anteil der Studienteilnehmenden, bei denen aus medizinischen und GKV-Gründen eine kieferorthopädische Behandlung grundsätzlich angezeigt sein kann, liegt somit bei insgesamt 97,5 Prozent."
Kieferprobleme machen krank
Wenn Kinder sich das Lächeln verkneifen, weil sie sich für ihre schiefen Zähne schämen, ist das schlimm genug. Aber es gibt auch gesundheitliche Folgen. Bei der Pressekonferenz zur Vorstellung der Studie sagte Konstantin von Laffert, Vizepräsident der Bundeszahnärztekammer: "Es wurde festgestellt, dass Kinder mit Zahn- und Kieferfehlstellungen mehr funktionelle Einschränkungen bei der Lebensqualität aufweisen, weil sie mehr Schwierigkeiten beim Kauen haben. Außerdem haben sie öfter Schmerzen im Mund." Unbehandelt können später auch Kopf- und Nackenschmerzen, Schwindel oder Zahnentzündungen dazukommen. Jürgen Boeven, Experte der DEVK Krankenversicherungs-AG, rät Eltern deshalb, auch bei leichten Fehlstellungen kieferorthopädischen Rat einzuholen: "Es ist immer sinnvoll, dass ein Profi bewertet, ob eine Behandlung nötig ist und welche Möglichkeiten es dafür gibt."
Je nachdem, wie lange die Behandlung dauert und welche Spangenart verwendet wird, kostet die Zahnregulierung bis zu 6.500 Euro. Eltern können privat vorsorgen: mit einer Krankenzusatzversicherung. Die leistet auch bei leichten Fehlstellungen. So bezuschusst die DEVK medizinisch sinnvolle kieferorthopädische Behandlungen schon ab KIG 2. Außerdem zahlt sie den vereinbarten Kostenanteil auch für Leistungen, die Praxen privat abrechnen müssen – zum Beispiel für die beliebten unsichtbaren Zahnspangen. Dazu gehören herausnehmbare, transparente Aligner-Zahnschienen ebenso wie Lingual-Zahnspangen, bei denen die Brackets an der Innenseite der Zähne befestigt sind. "Für Kita-Kinder scheinen Zahnspangen noch weit weg zu sein", so DEVK-Experte Jürgen Boeven. "Es lohnt sich aber, frühzeitig eine Krankenzusatzversicherung abzuschließen, weil die Behandlung nicht mehr versichert werden kann, wenn die Kiefer-Fehlstellung schon festgestellt wurde."
Krankenversicherungsschutz im Ausland: Auf Unterschiede bei Impfleistung und Auslandsnotfallservice achten!
Ab in den Urlaub: Um auch 2022 sorgenfrei verreisen zu können, gilt es im Vorfeld, das passende Paket für den Auslandskrankenschutz zu schnüren. Ein genauer Vergleich lohnt, denn der Leistungsumfang der gesetzlichen Krankenkassen unterscheidet sich in Sachen Auslandskrankenschutz beträchtlich. Je nachdem, ob das Urlaubsziel innerhalb der EU liegt oder eine Fernreise geplant ist, zahlen einige Kassen Zuschüsse zu Impfleistung oder den Auslandsnotfallservice, andere nicht.
Sind Sie also persönlich gut abgesichert?
Das Ziel der eigenen Reise ist in puncto Auslandskrankenschutz entscheidend. Denn ist der private Urlaub in einem EU-Staat geplant, besteht unabhängig vom Anbieter ein grundsätzlicher Schutz für Versicherte. „Innerhalb der EU können Versicherte Leistungen mit Ausnahme von Krankenhausbehandlungen auch ohne vorherige Zustimmung der gesetzlichen Krankenkasse in Anspruch nehmen“, weiß Thomas Adolph. Der Geschäftsführer des unabhängigen Vergleichsportals www.gesetzlichekrankenkassen.de weist dennoch darauf hin, dass sich der Leistungsumfang in der EU nach den jeweils landesüblichen Rechtsvorschriften richtet – und Kosten nur zu den Sätzen durch die gesetzlichen Krankenkassen erstattet werden, die sie auch in Deutschland zahlen müssten. „Wer in Italien zum Arzt muss, darf beim Versicherungsschutz hinsichtlich Leistungen und Kostenerstattung nicht automatisch vom deutschen Standard ausgehen“, so Thomas Adolph. Auch ein Rücktransport aus dem Ausland gehöre nicht zum Basisangebot der bundesweiten gesetzlichen Krankenkassen.
Auf Nummer sicher geht deshalb, wer zusätzlich zum gesetzlichen Schutz mit einer preisgünstigen Auslandsreise-Krankenversicherung gegen böse Überraschungen vorsorgt.
„Das Reiseziel ist in puncto Auslandskrankenschutz entscheidend – EU oder außerhalb der EU“
Liegt das Urlaubsziel im EU-Ausland, werden andere Themen wichtig. Für Fernreisen besonders relevant ist etwa die Frage, ob und in welchem Umfang Reiseschutzimpfungen bezahlt werden, zum Beispiel gegen Cholera, Gelbfieber, Hepatitis A und B oder Japanische Enzephalitis. Dabei gibt es große Unterschiede, wie ein Blick ins Vergleichsportal www.gesetzlichekrankenkassen.de zeigt. Von 97 gesetzlichen Krankenkassen gaben dort 37 an, die Kosten für den Impfstoff komplett zu übernehmen, abzüglich des gesetzlich vorgeschriebenen Eigenanteils. Die übrigen 32 Kassen, die Auskunft dazu gaben, zahlen entweder einen Kostenanteil von meist 80 Prozent oder legen einen maximalen Betrag der Kostenübernahme fest.
Bei den Kosten für die ärztliche Impfung verhält es sich ähnlich: 24 Kassen übernehmen vollständig, andere zahlen einen bestimmten Prozentsatz oder Festbetrag. 14 Krankenkassen bieten zudem ein sogenanntes Gesundheitskonto an – ein Budget, das für mehrere Leistungen von den Versicherten genutzt werden kann
Auch beim Auslandsnotfallservice lohnt sich ein genauer Check: „Wer im Thailandurlaub nach dem Rollercrash eine 24/7 erreichbare Hilfehotline der Krankenversicherung in der Hinterhand haben möchte, sollte vor Reiseantritt genau prüfen, ob diese Leistung auch durch die eigene Krankenkasse angeboten wird“, rät Thomas Adolph. 45 Krankenkassen gaben in seinem Vergleichsportal an, einen Auslandsnotfall-Service anzubieten – die Mehrzahl der rund 100 Gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland bietet eine solche Leistung also nicht an. Wer sich vorab informiert, ist nicht nur in einer Notfallsituation deutlich besser dran!
Ablaufdatum Corona-Impfzertifikat?
Aktuelle Verbraucherfrage: Ich habe auf meinem Handy die Meldung erhalten, dass mein Corona-Impfzertifikat bald abläuft. Was bedeutet das und was muss ich jetzt tun?
Michaela Rassat, Juristin der ERGO Rechtsschutz Leistungs-GmbH: Wer auf seinem Handy die Meldung erhält, dass sein Corona-Impfzertifikat bald abläuft, muss sich keine Sorgen machen. Aus technischen Gründen ist die Gültigkeit des digitalen Impfausweises auf 365 Tage nach Zertifikatsausstellung beschränkt. Dies ändert jedoch zumindest innerhalb Deutschlands nichts am Impfstatus. Um das digitale Zertifikat zu verlängern, können sich Geimpfte in jeder Apotheke ein neues Dokument ausstellen lassen. Nach dem Löschen des alten Eintrags ist es möglich, den QR-Code der neuen Bescheinigung einfach wieder über die Corona-Warn-App oder die Cov-Pass-App einzuscannen. Ab Juni soll dann eine Verlängerung direkt in den Apps möglich sein. Daher sollten Handynutzer ihre Corona-Apps immer auf dem neuesten Stand halten. Auch wenn der Impfstatus bei Besuchen in Restaurants, Geschäften oder im Kino in Deutschland aktuell nicht mehr nachgewiesen werden muss, kann das Zertifikat für eine bevorstehende Urlaubsreise notwendig sein. Bei grenzüberschreitenden Reisen innerhalb der EU gilt das digitale Impfzertifikat für die Grundimpfung nur 270 Tage lang. Mit einem Booster wird es dann jedoch unbefristet anerkannt. Reisende sollten sich frühzeitig über Einreisebestimmungen und die Gültigkeit ihres Zertifikats informieren. Alternativ kann der Impfstatus für die Einreise in viele Länder auch weiterhin mit dem gelben Impfausweis nachgewiesen werden. Für die Einreise in manche Länder außerhalb der EU ist der Impfpass in Papierform Voraussetzung.
Heuschnupfen: Medikamente und Therapien vom Finanzamt bezuschussen lassen
Die meisten Menschen genießen den Frühling regelrecht. Sie erfreuen sich am blauen Himmel, den ersten wärmenden Sonnenstrahlen, den farbigen Krokussen am Wegesrand und den leuchtend goldgelben Forsythien. Andere würden die Jahreszeit ebenfalls gerne genießen, sind aber von juckenden Augen, laufender Nase, Niesanfällen, Abgeschlagenheit oder akuter Atemnot geplagt. Die Rede ist von Pollenallergikern. Betroffen ist rund ein Viertel der Bevölkerung. Ihr Aufenthalt im Freien ist getrübt und erfordert aufgrund intensiver körperlicher Reaktionen oftmals die Einnahme von Medikamenten. Das kann das Haushaltsbudget belasten, zumal Allergien erblich bedingt sein können und sich in gewissen Familien häufen. "Gibt es hier eine Möglichkeit, die Kosten von der Steuer abzusetzen, Herr Gerauer?" Der Steuerberater und Vorstand der Lohnsteuerhilfe Bayern (Lohi) gibt Antworten.
Sind frei verkäufliche Medikamente absetzbar?
Die Mehrheit der Medikamente zur Linderung von Heuschnupfensymptomen ist frei verkäuflich. Für Augentropfen oder Nasensprays aus dem Drogeriemarkt gibt es keine Möglichkeit, steuerlich etwas zurückzuholen. Werden dieselben Mittelchen oder Medikamente wie Antihistaminika aber von einem Arzt auf Rezept verschrieben, so können auch frei verkäufliche Medikamente als außergewöhnliche Belastungen steuerlich geltend gemacht werden. Voraussetzung ist, dass eine ärztliche Verordnung vorliegt. Bei chronischen Krankheiten, zu denen Allergien zählen, reicht ein einmaliges ärztliches Attest aus. Es muss also nicht vor jedem Kauf in der Apotheke ein erneutes Rezept eingeholt werden. Bei rezeptpflichtigen Medikamenten, wie z.B. Kortison-Sprays, können die Rezeptgebühren ebenfalls steuerlich berücksichtigt werden.
Erkennt das Finanzamt nur schulmedizinische oder auch alternative Therapien an?
Auch schulmedizinische oder alternative Therapien, wie Desensibilisierung, Akupunktur oder Bioresonanz, die eine Linderung der Allergien bewirken können, können regelmäßig als Krankheitskosten bei der Steuer angesetzt werden. Folgende Voraussetzungen sind zu erfüllen: Erstens, die Krankenkasse oder Zusatzversicherung hat nicht die gesamten Kosten der Therapie übernommen. Mögliche Erstattungen sind unabhängig vom Erstattungszeitpunkt bei der Steuererklärung immer abzuziehen. Werden Bezuschussungs- oder Kostenübernahmeansprüche, z.B. aufgrund einer anvisierten Beitragsrückerstattung, gegenüber der Versicherung nicht geltend gemacht, muss das Finanzamt diese Aufwendungen nicht berücksichtigen. Zweitens, die Behandlung muss von einem Therapeuten, der den staatlich anerkannten Heilberufen angehört, durchgeführt werden. Der aufgesuchte Heilpraktiker muss also amtlich zugelassen sein. Drittens, noch vor Beginn der Therapie muss ein Attest vorliegen, das die Notwendigkeit der Therapie bestätigt. Für schulmedizinische und wissenschaftlich anerkannte Behandlungen reicht ein normales ärztliches Attest aus. Handelt es sich um wissenschaftlich nicht anerkannte Heilmethoden, ist ein amtsärztliches Attest oder eine Bescheinigung des medizinischen Dienstes der Krankenkassen erforderlich.
Sind diese Punkte erfüllt, sollten die Fahrtkosten zur Behandlung in der Steuererklärung nicht vergessen werden. Bei wöchentlichen Fahrten zum Therapeuten über mehrere Jahre hinweg kann da ein ordentlicher Betrag zusammenkommen. Wobei die Fahrtkosten prinzipiell auf die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel abgestellt sind. Wird der eigene PKW genutzt, sind die Kosten auf die Höhe der Tickets von öffentlichen Verkehrsmitteln beschränkt. Nur in besonderen Fällen sind Kfz-Kosten mit 30 Cent je Kilometer ansetzbar. Das trifft zu, wenn es keine öffentliche Verkehrsanbindung gibt oder diese nicht zumutbar ist.
Wie werden außergewöhnliche Belastungen in der Steuer erklärt?
Alles, was ein Arzt zur Linderung von Symptomen oder Heilung verordnet und nicht von Dritten bezahlt wird, zählt zu den Krankheitskosten. Diese können in der Steuererklärung als außergewöhnliche Belastung geltend gemacht werden. Damit diese jedoch einkommensteuerreduzierend wirken, ist die Grenze der zumutbaren Eigenbelastung zu überschreiten. Für den Selbstbehalt gibt es keine generelle Grenze. Dieser individuelle Eigenanteil liegt zwischen einem und sieben Prozent der jährlichen Einkünfte und hängt von der Einkommenshöhe, dem Familienstand und der Kinderanzahl ab.
Eine alleinstehende Person mit 40.000 Euro Jahreseinkommen muss bis zu einem Grenzbetrag von circa 2.246 Euro beispielsweise alle Gesundheitskosten selbst übernehmen. Erst wenn der Betrag überschritten ist, sind die Kosten darüber hinaus in voller Höhe abziehbar. Bei einer Familie mit zwei Kindern und 80.000 Euro Jahreseinkommen liegt der Grenzbetrag nicht sehr viel höher, nämlich bei rund 2.535 Euro. Um die magische Schwelle zu knacken, müssen also höhere Kosten für Krankheiten und damit möglicherweise noch weitere Krankheitskosten vorliegen.
Verwirrung um digitale Krankschreibung kann Patienten Krankengeld kosten
Verbraucherzentrale Hamburg rät zur verbindlichen Absprache mit Ärztinnen und Ärzten
Liegt eine ausgestellte Krankschreibung nicht bei der gesetzlichen Krankenkasse vor, zahlt diese auch kein Krankengeld. Davor warnt die Verbraucherzentrale Hamburg vor dem Hintergrund der jüngsten Verwirrungen um die Einführung der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (eAU). Lag es bis Ende 2021 noch in der Verantwortung der Patientinnen und Patienten, ihrer Kasse den Durchschlag einer ausgestellten AU zu übermitteln, sollte dies seit dem 1. Januar von den Arztpraxen auf digitalem Wege übernommen werden. Allerdings galt zunächst eine Übergangsfrist und Testphase, die nun auf unbestimmte Zeit verlängert wurde. Damit verlängert sich auch die Unsicherheit für Patientinnen und Patienten: „Patientinnen und Patienten wissen nun faktisch nicht, ob sie sich noch um die Übermittlung der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung an die Krankenkasse kümmern müssen oder nicht – die elektronische AU sollte dies ja eigentlich überflüssig machen“, so Dr. Jochen Sunken von der Verbraucherzentrale Hamburg.
Erkrankte Patientinnen und Patienten sollten sich daher erkundigen, wie dies in ihrer Praxis gehandhabt wird: „Fragen Sie im Zweifel direkt Ihren Arzt bzw. Ihre Ärztin“, empfiehlt Dr. Sunken. „In unserer Beratung haben wir immer wieder Fälle, in denen die Krankenkasse eine AU nicht erhalten hat und den Patientinnen und Patienten dadurch Nachteile entstehen.“ Problematisch ist dies insbesondere für Bezieherinnen und Bezieher von Krankengeld. „Dass eine AU nicht bei der Krankenkasse eingegangen ist, bemerken Patientinnen und Patienten häufig erst dann, wenn die Zahlung der Kasse ausbleibt. Oft fehlt dann gleich das Krankengeld für 14 Tage.“
Grundsätzlich befürworten die Verbraucherschützer die Einführung der elektronischen AU. „Der Nutzen der eAU für Patientinnen und Patienten ist unbestreitbar – daher sollte hieran festgehalten werden“, plädiert Dr. Sunken.
Kritisch sehen die Verbraucherschützer die aktuelle Diskussion um die eAU. „Wir können nicht einschätzen, ob es sich bei den derzeitigen Problemen um überwindbare Kinderkrankheiten eines neuen Systems handelt, oder ob es wirklich größere technische Probleme gibt. Wir können uns aber des Eindrucks nicht erwehren, dass die derzeitige Verwirrung dafür genutzt wird, eine unliebsame Reform zu verhindern“, so Dr. Sunken.
Versicherungstipp: Vorsorgetermin beim Zahnarzt nicht vergessen
Durch regelmäßige Zahnkontrolle können Zahnerkrankungen im Frühstadium erkannt und besser behandelt werden. Aber auch finanziell lohnt es sich, die jährlichen Vorsorgeuntersuchungen wahrzunehmen. Gesetzlich Krankenversicherte erhalten bei Zahnersatz einen Festzuschuss für Kronen, Brücken und Prothesen. Dieser deckt 60 Prozent der Durchschnittskosten für eine einfache Regelversorgung ab.
„Wer regelmäßig zur Zahnvorsorge geht, wird mit einem höheren Zuschuss belohnt“, erklärt die uniVersa Versicherung. Wurde das Zahnbonusheft lückenlos über fünf Jahre geführt, erhöht sich der Festzuschuss auf 70 Prozent, bei über zehn Jahren sogar auf 75 Prozent. Wer in diesem Jahr noch nicht bei der Zahnkontrolle war, sollte sich beeilen.
Bei Erwachsenen reicht für das Bonusheft eine jährliche Kontrolle aus. Bei Kindern ab 6 Jahren und Jugendlichen sind zwei Stempel pro Jahr erforderlich. Bereits 16,4 Millionen Deutsche sorgen mit einer privaten Zahnzusatzversicherung vor, um sich vor hohen Eigenbeteiligungen vor allem bei hochwertigem Zahnersatz und Implantaten zu schützen. Auch hier wird regelmäßige Zahnvorsorge vielfach in den Tarifen belohnt und führt zu höheren Leistungen, so die uniVersa.
Nach Corona: Kosten für die Behandlung psychischer Krankheiten absetzen
Die Inzidenzwerte sind viele Wochen lang gesunken, seither befassen sich etliche Medien mit den möglichen Folgen der Corona-Krise - darunter auch die Behandlung psychischer Krankheiten. Der Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH) zeigt, in welchen Fällen Betroffene die Kosten für die psychologische oder psychotherapeutische Hilfe von der Steuer absetzen können.
Die Coronapandemie hat weltweit zu psychischen Belastungen in der Bevölkerung geführt. Dazu zählen einer 2021 erhobenen Metaanalyse der Zeitschrift Globalization and Health zufolge vor allem Angststörungen und Depressionen, wie das Ärzteblatt am 4. Mai 2021 berichtete.
Für Betroffene ist es zunächst am Wichtigsten, professionelle Hilfe durch eine Psychologin / einen Psychologen oder eine Psychotherapeutin / einen Psychotherapeuten zu erhalten, die oder der zu einem passt und schnell freie Termine hat. Doch irgendwann stellt sich auch die Frage, wer die Kosten einer solchen Behandlung trägt - und in welchen Fällen die Ausgaben von der Steuer abgesetzt werden können.
Fall 1: Krankenkasse zahlt einen Teil, der Rest ist absetzbar
Krankenkassen übernehmen in der Regel die Behandlungskosten für eine psychologische Behandlung, sofern es sich um eine ärztlich diagnostizierte psychische Störung mit "Krankheitswert" handelt - zum Beispiel Angststörungen oder Depressionen. Trägt die Krankenkasse die kompletten Kosten, lassen sich zumindest die damit zusammenhängende Nebenkosten wie zum Beispiel die Fahrtkosten zur Therapie von der Steuer absetzen.
Anders verhält es sich, wenn die Krankenkasse nur einen Teil der Behandlung zahlt, was je nach Dauer, Behandlungsverfahren oder Diagnose variieren kann. Sind die Kosten höher als der Zuschuss der Krankenkasse, dann spricht die Bezuschussung durch die Krankenkassen dafür, dass es sich um Krankheitskosten im steuerlichen Sinn handelt.
Fall 2: Krankenkasse zahlt nichts, mit Attest können Kosten abgesetzt werden
Es gibt Erkrankungen, deren Behandlung von den gesetzlichen Krankenkassen bisher nicht bezahlt oder bezuschusst werden. Dazu gehört zum Beispiel die Behandlung des Burnout-Syndroms.
Betroffene können die Kosten für eine solche, von der Krankenkasse nicht getragene Behandlung dann von der Steuer absetzen, wenn vor der Behandlung ein amtsärztliches Attest oder eine Bescheinigung des Medizinischen Diensts der Krankenversicherungen (MDK) eingeholt wurde. Betroffene sollten dazu am besten mit ihrem behandelnden Arzt sprechen.
Krankheitskosten: Kürzung um die "zumutbare Belastung"
Krankheitskosten zählen steuerlich zu den außergewöhnlichen Belastungen. Bei diesen Kosten rechnet das Finanzamt eine zumutbare Eigenbelastung an. Diese Belastungsgrenze richtet sich individuell nach der Höhe Ihrer Einkünfte, Ihrem Familienstand und der Anzahl Ihrer Kinder. Wer mit all seinen außergewöhnlichen Belastungen - dazu zählen neben den Krankheitskosten beispielsweise auch Pflegekosten - die eigene zumutbare Belastungsgrenze überschreitet, der kann im Prinzip unbegrenzt seine Kosten absetzen.
Urteil: Auch Single-Frauen dürfen Kosten für künstliche Befruchtung absetzen
Das Finanzgericht Münster hat entschieden, dass eine Frau 12.000 Euro für eine Kinderwunschbehandlung als außergewöhnliche Belastung in die Steuererklärung eintragen darf. Das Besondere: Die Frau ist unverheiratet und 40 Jahre alt. Der Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe (VLH) erläutert die Details.
Bislang galten unter anderem folgende Bedingungen, um die Kosten für eine künstliche Befruchtung von der Steuer absetzen zu können:
- Nur wer verheiratet ist, darf die Kosten der Behandlung in seiner Steuererklärung angeben.
- Die Frau darf nicht älter als 40 Jahre sein und der Mann nicht älter als 50 Jahre.
Finanzgericht Münster:Beziehungsstatus spielt keine Rolle
Laut dem aktuellen Urteil des Finanzgerichts Münster (24. Juni 2020, Az. 1 K 3722/18 E), das Anfang August veröffentlicht wurde, kommt es nicht auf den Beziehungsstatus an, um die Kosten für eine künstliche Befruchtung absetzen zu können. Damit gaben die Richter aus Münster einer Frau Recht, die an krankheitsbedingter Unfruchtbarkeit leidet.
Die 40-Jährige gab in ihrer Einkommensteuererklärung Kosten für eine Kinderwunschbehandlung in Höhe von 12.000 Euro als außergewöhnliche Belastung an. Darin waren auch Kosten für eine Samenspende enthalten. Das zuständige Finanzamt lehnte die Anerkennung dieser Kosten mit der Begründung ab, dass nur verheiratete Frauen oder Frauen in einer festen Beziehung derlei Ausgaben absetzen dürften. Die Frau hatte aber keine Angaben zu ihrem Beziehungsstatus gemacht.
Schwangerschaften von Frauen über 40 heutzutage normal
Die Frau klagte, und das Finanzgericht Münster entschied nicht nur, dass ihr Beziehungsstatus keine Rolle für die Absetzbarkeit der Kosten spielt, sondern auch, dass die Unfruchtbarkeit der 40-Jährigen einen Krankheitszustand darstellt. Das sei nicht auf ihr Alter zurückzuführen. In der heutigen Zeit seien Schwangerschaften von Frauen über 40 außerdem nicht ungewöhnlich, so die Richter. Fazit: Auch eine alleinstehende Frau über 40 kann die Kosten der künstlichen Befruchtung als außergewöhnliche Belastung von der Steuer absetzen, wenn sie krankheitsbedingt unfruchtbar ist.
Die VLH empfiehlt: Nachweise sammeln und in der Steuererklärung angeben
Die Finanzverwaltung kann gegen das Urteil des Finanzgerichts Münster in Revision gehen. In letzter Instanz muss dann der Bundesfinanzhof (BFH) entscheiden, ob unverheiratete Frauen von 40 Jahren und älter die Kosten für eine künstliche Befruchtung absetzen können oder nicht. Bis dahin empfiehlt die VLH allen betroffenen Frauen, die entsprechenden Nachweise zu sammeln und die Kosten in ihrer Einkommensteuererklärung anzugeben.
Kosten für Medikamente von der Steuer absetzen: So funktioniert's
Kopfschmerztabletten, Nasenspray oder Hustensaft: Eine Hausapotheke hilft schnell bei kleineren Alltagskrankheiten. Die Kosten dafür lassen sich von der Steuer absetzen, wenn der Arzt die Medikamente verschrieben hat. Worauf Sie dabei achten sollten und wie die aktuelle Rechtsprechung dazu aussieht, erklärt der Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH).
Entscheidend ist, dass das ärztliche Rezept vor dem Kauf ausgestellt wurde. Seit 2009 ist diese Rechtsprechung gültig, das Finanzgericht Rheinland-Pfalz bestätigte das sogar in einem Urteil (Aktenzeichen 5 K 2157/12).
Früher: Rezept nachträglich ausstellen lassen
Bis 2009 war es möglich, ein Medikament erst in der Apotheke zu kaufen, danach zum Arzt zu gehen und sich ein Rezept ausstellen zu lassen, und anschließend die Kosten für das Medikament von der Steuer abzusetzen. Das geht heute - über zehn Jahre später - nicht mehr.
Jetzt: Erst zum Arzt, dann in die Apotheke
Heute gilt Folgendes: Erst zum Arzt, dann Medikament kaufen und anschließend die Kosten, die von der Krankenkasse nicht gezahlt wurden, in die Steuererklärung eintragen.
Außerdem müssen die Medikamente der Heilung oder Linderung einer Krankheit dienen. Ausgaben für eine Krankheitsvorbeugung können dagegen in der Regel nicht abgesetzt werden. Sind alle Voraussetzungen erfüllt, zählen die Kosten für Medikamente zu den sogenannten außergewöhnlichen Belastungen. Dafür gibt es in der Steuererklärung seit 2019 eine eigene Anlage.
Zu den absetzbaren Krankheitskosten gehören üblicherweise auch die Ausgaben - genau wie Zuzahlungen - für die Geburt eines Kindes, Homöopathie, Impfungen, eine Brille, Krankengymnastik oder Behandlungen beim Zahnarzt sowie die Zahnspange.
Guter Vorsatz: Nichtraucher auf Staatskosten
Raucherentwöhnung: Entwöhnungsmittel und Therapien sind absetzbar
Aufhören mit dem Rauchen, das wünschen sich viele Raucher. Doch wird häufig auf den richtigen Zeitpunkt gewartet. So werden gerade zum Jahreswechsel Pläne für das neue Jahr geschmiedet. Doch fällt es meist schwer, die guten Vorsätze im neuen Jahr umzusetzen oder den Zigarettenverzicht auf Dauer durchzuhalten. Mit einer konkreten Zielvorstellung, einem eisernen Willen oder einem Anreiz fällt es leichter. Das Finanzamt bietet einen solchen, denn Raucherentwöhnung ist unter bestimmten Voraussetzungen steuerlich absetzbar, so der Tipp der Lohnsteuerhilfe Bayern.
Es gibt viele Methoden, sich das Rauchen abzugewöhnen. Wer innerlich nicht stark genug ist, effektiv abrupt damit aufzuhören, der versucht entweder schrittweise seinen Zigarettenkonsum zu reduzieren, greift auf nikotinhaltige Ersatzprodukte wie Kaugummis, Pflaster oder E-Zigaretten zurück oder begibt sich in Therapie. Ob ambulante Entwöhnungsseminare, Selbsthilfegruppen, alternative Methoden wie Hypnose oder Akupunktur oder ein stationärer Klinikaufenthalt, die Angebote sind zahlreich und teilweise kostenintensiv.
Während einige Therapien von den Krankenkassen in unterschiedlicher Höhe bezuschusst oder ganz übernommen werden, dürfen nikotinhaltige Ersatzprodukte von den Krankenkassen nicht erstattet werden. Die Kosten für medizinische Mittel und Therapien, die für die Heilung einer Sucht entstehen, dürfen abzüglich der Krankenkassenzahlungen bei Erbringung bestimmter Nachweise als außergewöhnliche Belastung in der Einkommensteuererklärung geltend gemacht werden. Eine Nikotinsucht wird steuerlich wie jede andere Krankheit behandelt. Insofern wirken sich die Kosten steuerlich dann aus, wenn die persönliche Zumutbarkeitsgrenze überschritten wird.
Grundlegend benötigt der Raucher vorab ein haus- oder fachärztliches Attest, das bescheinigt, dass eine Nikotinsucht vorliegt. Ebenfalls müssen die im Anschluss genutzten apothekenpflichtigen Präparate von einem Arzt verordnet werden. Suchtmittel selbst und somit E-Zigaretten werden selbstverständlich steuerlich nicht gefördert. Für den Abzug von Kosten für Psychotherapien, Selbsthilfegruppen oder Heilkuren ist darüber hinaus ein vorher ausgestelltes amtsärztliches Attest notwendig. Die Kur selbst muss der Heilung der Sucht dienen und setzt in der Regel voraus, dass andere Methoden der Entwöhnung nicht erfolgversprechend sind.
Neben den Kosten für die Entwöhnungsmittel und Therapien sind auch die Gebühren für den Arzt oder Heilpraktiker und diverse Fahrkosten absetzbar, so die Lohnsteuerhilfe Bayern. Für Fahrten zum Arzt oder Heilpraktiker sowie zur Selbsthilfegruppe, den Entwöhnungsseminaren oder Kliniken können 30 Cent je Kilometer angesetzt werden. Bei der Erstellung der Einkommensteuererklärung ist darauf zu achten, dass die benötigten Nachweise wie Arztrezepte und Rechnungen vorliegen. Auch kann vom Finanzamt ein Schreiben der Krankenkasse verlangt werden, das Aufschluss über Zuschüsse der Krankenkasse gibt.
Weihnachten und Silvester: Apothekenfinder 22 8 33 hilft bei der Suche nach Notdienst-Apotheken
Mit dem Apothekenfinder 22 8 33 lassen sich zu Weihnachten und Silvester schnell und unkompliziert die jeweils nacht- und notdienstleistenden Apotheken überall in Deutschland finden. Darauf weist die ABDA - Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände hin, die diesen Service bundesweit anbietet. Ob Rügen oder Schwarzwald, Taunus oder Lausitz - etwa 1.300 Apotheken versorgen nachts, sonntags und an allen Feiertagen die Menschen jederzeit mit dringenden Arzneimitteln. Der Apothekenfinder 22 8 33 wird pro Jahr rund 15 Millionen mal für solche Apothekensuchen in Anspruch genommen, davon fast 14 Millionen mal online über das Verbraucherportal www.aponet.de. Aber auch jeweils eine halbe Million mal werden die Smartphone-App und die mobile Webseite von Patienten und deren Angehörigen genutzt.
Wer zu Weihnachten oder Silvester eine nacht- oder notdiensthabende Apotheke am Heimat- oder Urlaubsort sucht, kann zwischen folgenden Optionen des Apothekenfinders auswählen: Die kostenfreie App für Smartphones gehört ebenso zum Angebot wie die mobile Webseite für Handys. Per Mobiltelefon kann man bundesweit ohne Vorwahl die 22 8 33 anrufen oder eine SMS mit der fünfstelligen Postleitzahl dorthin schicken (69 Cent pro Minute/SMS). Von zu Hause aus können Patienten kostenfrei die Festnetznummer 0800 00 22 8 33 wählen oder auf das Gesundheitsportal www.aponet.de zugreifen. Darüber hinaus kann man sich natürlich auf die bekannten Optionen ohne technische Geräte verlassen: Die Kontaktdaten der nächstgelegenen Notdienstapotheken hängen immer im Apothekenschaufenster aus und werden in vielen Lokalzeitungen abgedruckt.
Kinderwunschbehandlung: Mehr Zuschüsse vom Staat, und welche Kosten sich absetzen lassen
Ob IUI, IVF oder ICSI, es gibt viele Methoden der künstlichen Befruchtung - doch alle sind teuer.
Immerhin haben der Bund und neun Bundesländer ihre Bezuschussung erhöht. Und immerhin lassen sich bestimmte Kosten der Kinderwunschbehandlung von der Steuer absetzen. Der Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH) mit den aktuellen Daten im Überblick.
Mehr als ein Drittel der Menschen zwischen 25 und 59 Jahren haben laut Bundesfamilienministerium einen unerfüllten Kinderwunsch (Pressemitteilung vom 18. September 2019). Nahezu jedes zehnte Paar ist demzufolge auf reproduktionsmedizinische Unterstützung angewiesen, um Nachwuchs zu bekommen. Folgendes sind dabei die gängigsten Methoden:
- Die Insemination (IUI) steht für die Samenübertragung direkt in die Gebärmutter. Kostenpunkt: ab 100 Euro zuzüglich Kosten für Medikamente.
- Die In-Vitro-Fertilisation (IVF) ist eine Befruchtung im Reagenzglas. Kostenpunkt: rund 1.500 Euro inklusive Medikamente.
- Bei der Intracytoplasmatischen Spermieninjektion (ICSI) wird das Spermium des Mannes direkt in das Zytoplasma einer Eizelle eingespritzt.
Kostenpunkt: rund 1.800 Euro inklusive Medikamente.
Staatliche Zuschüsse für vier statt nur drei Behandlungszyklen
Der Bund und neun Bundesländer gewähren Ehepaaren, die sich zur Erfüllung ihres Kinderwunsches einer Behandlung nach Art der In-vitro-Fertilisation (IVF) und der Intrazytoplasmatischen Spermieninjektion (ICSI) unterziehen, ab sofort im ersten bis vierten Behandlungszyklus einen Behandlungskostenzuschuss - zuvor waren es lediglich drei Behandlungszyklen, die bezuschusst wurden.
Bis zu 50 Prozent der Kosten, die ein Paar abzüglich des Krankenkassenanteils selbst zahlen muss, werden laut Bundesfamilienministerium bezuschusst. Dadurch kann sich der Eigenanteil auf bis zu 25 Prozent der Behandlungskosten reduzieren.
Den vierten Versuch mussten betroffene Paare als Mitglieder der gesetzlichen Krankenkassen bislang komplett selbst zahlen. Ab sofort werden ihnen bis zu 50 Prozent ihrer Kosten bezuschusst.
Auch Paare, die nicht verheiratet sind, erhalten in den sich beteiligenden Bundesländern höhere staatliche Zuschüsse, nämlich bis zu 12,5 Prozent für die erste und dritte Behandlung und bis zu 25 Prozent für die vierte Behandlung.
An der Initiative "Hilfe und Unterstützung bei ungewollter Kinderlosigkeit" beteiligen sich die Bundesländer Berlin, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfahlen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Hessen und Brandenburg. Weitere Informationen finden Sie unter www.informationsportal-kinderwunsch.de.
Diese Kosten bei Kinderwunschbehandlung lassen sich absetzen
Egal ob IUI, IVF oder ICSI: Wer einen Teil der Kosten zur künstlichen Befruchtung selbst tragen muss, kann die Ausgaben in seiner Steuererklärung angeben. Sie gelten als außergewöhnliche Belastung, da die Kosten einer künstlichen Befruchtung im Steuerrecht zu den Krankheitskosten zählen. Alle Kosten rund um die Kinderwunschbehandlung - dazu zählen die Behandlung selbst, Kosten für Medikamente sowie die Fahrten zum Frauenarzt oder dem Kinderwunschzentrum - können von der Steuer abgesetzt werden.
Auch unverheiratete Paare können Kosten ihrer Kinderwunschbehandlung als außergewöhnliche Belastung absetzen, nämlich die Kosten für eine In-Vitro-Fertilisation. Das hat der Bundesfinanzhof 2007 entschieden. Wichtig ist, dass die Behandlungsmethode mit den Richtlinien der Berufsordnung für Ärzte in Einklang steht. Der behandelnde Arzt muss demnach davon überzeugt sein, dass das Paar in einer "festgefügten Partnerschaft" lebt und der Mann die Vaterschaft anerkennen wird. Es darf nur der Samen des Partners verwendet werden.
Seit einem Urteil des Bundesfinanzhofs 2017 sind Aufwendungen einer unfruchtbaren Frau für eine IVF auch dann als außergewöhnliche Belastung absetzbar, wenn die Frau in einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft lebt. Begründung: Die "Empfängnisunfähigkeit einer Frau ist - unabhängig von Ihrem Familienstand - eine Krankheit" und Krankheitskosten sind steuerlich absetzbar. Zu diesen gehören, neben Kosten für Medikamente, Durchführung der IVF in einer Klinik und eventuelle Fahrten, auch Aufwendungen für die Bereitstellung und Aufbereitung der Spendersamen (Aktenzeichen VI R 47/15).
Volkskrankheit Burn-out: Jeder zweite Deutsche hatte schon mit Burn-out Symptomen zu kämpfen
Psychische Erkrankungen wie Burn-out entwickeln sich mehr und mehr zu Volkskrankheiten. Zwei Drittel der Deutschen halten die steigenden Burn-out-Fälle für ein echtes Alarmsignal. Ganz extrem: Die Hälfte der Bundesbürger hatte selbst schon einen Burn-out, das Gefühl kurz davor zu stehen oder kennt die Symptome aus eigener Erfahrung. Dementsprechend wichtig ist es, bei psychischen Problemen einen Psychiater aufzusuchen. Allerdings denken 15 Prozent der Deutschen noch immer, dass sie für einen Besuch beim "Psycho-Doc" abgestempelt würden. Andere europäische Länder sind hier deutlich offener - aber auch seltener in psychischer Behandlung. Das zeigt der repräsentative STADA Gesundheitsreport 2019 mit 18.000 Befragten in neun europäischen Ländern.
Wo in Europa ist Burn-out am weitesten verbreitet? In Osteuropa sagen die meisten, dass sie Burn-out-Symptome aus eigener Erfahrung kennen oder selbst schon einen Burn-out hatten. 72 Prozent der Russen, 66 Prozent der Serben und 62 Prozent der Polen hatten schon derartige Probleme. Belgier, Briten, Spanier und Italiener sind ähnlich häufig betroffen wie Deutsche - zwischen 49 und 52 Prozent von ihnen hatten nach eigenen Aussagen selbst schon einen Burn-out, das Gefühl kurz davor zu stehen oder kennen die Symptome aus eigener Erfahrung. Am seltensten betroffen sind Franzosen mit 44 Prozent.
35- bis 49-Jährige besonders Burn-out gefährdet
In Deutschland sind jüngere Menschen öfter von Burn-out geplagt als Ältere, das gilt insbesondere für 35- bis 49-Jährige. Also die Altersgruppe, die am häufigsten Kinder und Beruf unter einen Hut bringen muss. 15 Prozent von ihnen gibt an, schon einen Burn-out gehabt zu haben. Weitere 14 Prozent sagen, sie fühlen sich oft als stünden sie kurz davor und 26 Prozent hatten schon das Gefühl von Burn-out-Symptomen. Außerdem sind Frauen in Deutschland tendenziell eher gefährdet als Männer, gehen gleichzeitig aber auch offener mit psychischen Problemen um: Sie halten die steigenden Burn-out-Zahlen öfter für ein ernstes Alarmsignal (70 zu 63 Prozent) und sagen öfter, dass man sich für einen Besuch beim Psychiater natürlich nicht schämen müsse (53 zu 43 Prozent).
Besuch beim Psychiater
Und wie viele Deutsche waren selbst schon beim Psychiater oder Psychologen? Insgesamt 19 Prozent, also immerhin jeder Fünfte. Damit ist Deutschland Spitzenreiter in Europa. Nur Belgien (16 Prozent) und Spanien (15 Prozent) weisen hier ähnlich hohe Werte auf. In Serbien, Polen und Russland hingegen waren nur jeweils vier bis sieben Prozent schon beim Psychiater - obwohl (oder weswegen) es hier die meisten Burn-out-Fälle gibt. Gleichzeitig sagen die Deutschen aber auch am häufigsten, dass man für einen Besuch beim "Psycho-Doc" abgestempelt werden würde. In der Bundesrepublik denken 15 Prozent so, in Italien und Spanien zum Beispiel nur sechs bzw. acht Prozent.
Beim genaueren Blick auf Deutschland zeigt sich, dass Geschiedene (25 Prozent) und Singles (23 Prozent) viel häufiger als Verheiratete (15 Prozent) zum Psychologen gehen. Das gilt auch für Geringverdiener: 30 Prozent der Menschen mit einem Nettoeinkommen von unter 1.500 Euro waren bereits beim "Psycho-Doc".
Arbeitgeber in der Pflicht?
Viele der Befragten halten die steigenden psychischen Krankheitsfälle auch für ein Problem der modernen Arbeitswelt. Besonders die Deutschen sehen Arbeitgeber in der Pflicht zur Gesundheitsprävention: 40 Prozent fordern Workshops zur Burn-out-Prävention (Europadurchschnitt 32 Prozent) und 55 Prozent möchten Überstunden fair ausgeglichen haben, um Stress zu verhindern (Europadurchschnitt 41 Prozent).
Wer übernimmt die Kosten für eine Notfall-Zahnbehandlung im Ausland?
Zahnschmerzen sind richtig unangenehm. Treten sie im Urlaub auf, ist das besonders ärgerlich. Manchmal ist dann ein Zahnarztbesuch im Urlaubsland unerlässlich.
Wer in der Europäischen Union (EU) oder in Island, Norwegen, Liechtenstein, Kroatien, Mazedonien, Serbien oder der Schweiz unterwegs ist, für den reicht die europäische Krankenversicherungskarte (EHIC) der gesetzlichen Krankenversicherung meist aus. Aber: Reisende dürfen sich dann nur von Ärzten des öffentlichen Gesundheitssystems vor Ort behandeln lassen, nicht von Privatärzten. Die Krankenkasse erstattet auch ausschließlich die Kosten einer vergleichbaren Behandlung in Deutschland. Da im Ausland die Zahnbehandlung häufig teurer oder wie etwa in Spanien gar nicht Teil des gesetzlichen Leistungsspektrums ist, bleiben Urlauber auf den (Zusatz-)Kosten sitzen. Die kompletten Kosten übernimmt nur eine private Reisekrankenversicherung. Und das nicht nur innerhalb der EU, sondern weltweit. Aber auch mit einer guten Police im Gepäck kann der Zahnarztbesuch zum Abenteuer werden: Wegen der Sprachbarrieren. Auf der Website der Initiative proDente finden Reisende einen Sprachführer in sieben Sprachen, der eine unkomplizierte Kommunikation ermöglicht. Kunden der ERGO Reiseversicherung können außerdem auf die ERV travel & care App zugreifen. Sie hilft unter anderem dabei, am Urlaubsort einen Zahnarzt zu finden, so Birgit Dreyer, Expertin der ERGO Reiseversicherung.
Wirksame Patientenverfügung zum Abbruch lebenserhaltender Maßnahmen
BGH-Beschluss vom 14. November 2018 - XII ZB 107/18
Der u.a. für Betreuungssachen zuständige XII. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat sich erneut mit den Anforderungen befasst, die eine Patientenverfügung im Zusammenhang mit dem Abbruch von lebenserhaltenden Maßnahmen erfüllen muss.
Die im Jahr 1940 geborene Betroffene erlitt im Mai 2008 einen Schlaganfall und befindet sich seit einem hypoxisch bedingten Herz-Kreislaufstillstand im Juni 2008 in einem wachkomatösen Zustand. Sie wird seitdem über eine Magensonde künstlich ernährt und mit Flüssigkeit versorgt.
Bereits im Jahr 1998 hatte die Betroffene ein mit "Patientenverfügung" betiteltes Schriftstück unterschrieben. In diesem war niedergelegt, dass unter anderem dann, wenn keine Aussicht auf Wiedererlangung des Bewusstseins besteht oder aufgrund von Krankheit oder Unfall ein schwerer Dauerschaden des Gehirns zurückbleibe, "lebensverlängernde Maßnahmen unterbleiben" sollen.
Zu nicht genauer festgestellten Zeitpunkten von 1998 bis zu ihrem Schlaganfall hatte die Betroffene mehrfach gegenüber verschiedenen Familienangehörigen und Bekannten angesichts zweier Wachkoma-Patienten aus ihrem persönlichen Umfeld geäußert, sie wolle nicht künstlich ernährt werden, sie wolle nicht so am Leben erhalten werden, sie wolle nicht so daliegen, lieber sterbe sie. Sie habe durch eine Patientenverfügung vorgesorgt, das könne ihr nicht passieren. Im Juni 2008 erhielt die Betroffene einmalig nach dem Schlaganfall die Möglichkeit, trotz Trachealkanüle zu sprechen. Bei dieser Gelegenheit sagte sie ihrer Therapeutin: "Ich möchte sterben."
Unter Vorlage der Patientenverfügung von 1998 regte der Sohn der Betroffenen im Jahr 2012 an, ihr einen Betreuer zu bestellen. Das Amtsgericht bestellte daraufhin den Sohn und den Ehemann der Betroffenen zu jeweils alleinvertretungsberechtigten Betreuern.
Der Sohn der Betroffenen ist, im Einvernehmen mit dem bis dahin behandelnden Arzt, seit 2014 der Meinung, die künstliche Ernährung und Flüssigkeitszufuhr solle eingestellt werden, da dies dem in der Patientenverfügung niedergelegten Willen der Betroffenen entspreche. Ihr Ehemann lehnt dies ab.
Den Antrag der Betroffenen, vertreten durch ihren Sohn, auf Genehmigung der Einstellung der künstlichen Ernährung und Flüssigkeitszufuhr hat das Amtsgericht abgelehnt. Die dagegen gerichtete Beschwerde der Betroffenen hatte das Landgericht zunächst zurückgewiesen. Nach Aufhebung dieser Entscheidung durch den Senat (Senatsbeschluss vom 8. Februar 2017 – XII ZB 604/15 – FamRZ 2017, 748) und Zurückverweisung der Sache an das Landgericht hat dieses ein Sachverständigengutachten zu der Frage eingeholt, ob der konkrete Zustand der Betroffenen im Wachkoma ihr Bewusstsein entfallen lässt und ob in diesem Fall eine Aussicht auf Wiedererlangung des Bewusstseins besteht. Nachdem der Sachverständige sein Gutachten auch mündlich erläutert hatte, hat das Landgericht die Beschwerde der Betroffenen nun mit der Maßgabe zurückgewiesen, dass eine gerichtliche Genehmigung nicht erforderlich ist. Die hiergegen gerichtete Rechtsbeschwerde des Ehemanns der Betroffenen hatte keinen Erfolg.
Der Abbruch einer lebenserhaltenden Maßnahme bedarf dann nicht der betreuungsgerichtlichen Genehmigung nach § 1904 Abs. 2 BGB, wenn der Betroffene einen entsprechenden eigenen Willen bereits in einer wirksamen Patientenverfügung (§ 1901 a Abs. 1 BGB) niedergelegt hat und diese auf die konkret eingetretene Lebens- und Behandlungssituation zutrifft. In diesem Fall hat der Betroffene diese Entscheidung selbst in einer alle Beteiligten bindenden Weise getroffen, so dass eine Einwilligung des Betreuers, die dem betreuungsgerichtlichen Genehmigungserfordernis unterfällt, in die Maßnahme nicht erforderlich ist. Wird das Gericht dennoch angerufen, weil eine der beteiligten Personen Zweifel an der Bindungswirkung einer Patientenverfügung hat und kommt das Gericht zu dem Ergebnis, dass eine wirksame Patientenverfügung vorliegt, die auf die aktuelle Lebens- und Behandlungssituation zutrifft, hat es auszusprechen, dass eine gerichtliche Genehmigung nicht erforderlich ist (sogenanntes Negativattest).
Nach der Rechtsprechung des Senats entfaltet eine Patientenverfügung allerdings nur dann unmittelbare Bindungswirkung, wenn sich feststellen lässt, in welcher Behandlungssituation welche ärztlichen Maßnahmen durchgeführt werden bzw. unterbleiben sollen. Die Anforderungen an die Bestimmtheit einer Patientenverfügung dürfen dabei jedoch nicht überspannt werden. Vorausgesetzt werden kann nur, dass der Betroffene umschreibend festlegt, was er in einer bestimmten Lebens- und Behandlungssituation will und was nicht. Maßgeblich ist nicht, dass der Betroffene seine eigene Biografie als Patient vorausahnt und die zukünftigen Fortschritte in der Medizin vorwegnehmend berücksichtigt. Nicht ausreichend sind jedoch allgemeine Anweisungen, wie die Aufforderung, ein würdevolles Sterben zu ermöglichen oder zuzulassen, wenn ein Therapieerfolg nicht mehr zu erwarten ist. Auch die Äußerung, "keine lebenserhaltenden Maßnahmen" zu wünschen, enthält jedenfalls für sich genommen keine hinreichend konkrete Behandlungsentscheidung.
Im Einzelfall kann sich die erforderliche Konkretisierung bei einer weniger detaillierten Benennung bestimmter ärztlicher Maßnahmen durch die Bezugnahme auf ausreichend spezifizierte Krankheiten oder Behandlungssituationen ergeben kann. Ob in solchen Fällen eine hinreichend konkrete Patientenverfügung vorliegt, ist dann durch Auslegung der in der Patientenverfügung enthaltenen Erklärungen zu ermitteln.
Im vorliegenden Fall hat der Senat bereits in seinem Beschluss vom 8. Februar 2017 (XII ZB 604/15) ausgeführt, dass die Betroffene mit der Anknüpfung ihrer Regelungen zu den ärztlichen Maßnahmen, in die sie einwilligt oder nicht einwilligt, an die medizinisch eindeutige Feststellung, dass bei ihr keine Aussicht auf Wiedererlangung des Bewusstseins besteht, hinreichend konkret eine Lebens- und Behandlungssituation beschrieben hat, in der die Patientenverfügung Geltung beanspruchen soll.
Nach den vom Landgericht rechtsfehlerfrei durchgeführten weiteren Ermittlungen ist diese Lebens- und Behandlungssituation auch gegeben. Nach dem Inhalt des eingeholten neurologischen Sachverständigengutachtens besteht bei der Betroffenen eindeutig ein Zustand schwerster Gehirnschädigung, bei der die Funktionen des Großhirns - zumindest soweit es dessen Fähigkeit zu bewusster Wahrnehmung, Verarbeitung und Beantwortung von Reizen angeht - komplett ausgelöscht sind. Dieser Zustand ist nach Meinung des Sachverständigen irreversibel. Aufgrund dieser Feststellungen ist die Auffassung des Beschwerdegerichts, dass bei der Betroffenen keine Aussicht auf Wiedererlangung des Bewusstseins besteht und damit die Lebens- und Behandlungssituation vorliegt, an die die Betroffene in ihrer Patientenverfügung den Wunsch geknüpft hat, dass lebensverlängernde Maßnahmen unterbleiben sollen, aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden.
Außerdem hat das Landgericht umfassend und sorgfältig geprüft, ob die Patientenverfügung auch eine Einwilligung der Betroffenen in den Abbruch bereits eingeleiteter lebenserhaltender Maßnahmen beinhaltet. Hierbei hat es auf der Grundlage der schriftlichen Patientenverfügung zu Recht den Aussagen der vernommenen Zeugen besondere Bedeutung beigemessen, nach denen sich die Betroffene vor ihrer eigenen Erkrankung mehrfach dahingehend geäußert hatte, dass sie nicht künstlich ernährt werden wolle. Zudem hat sich das Beschwerdegericht im Rahmen seiner Auslegungserwägungen eingehend mit der Frage befasst, ob die in der Patientenverfügung enthaltene Formulierung "aktive Sterbehilfe lehne ich ab", dahingehend zu verstehen sein könnte, dass die Betroffene den Abbruch lebenserhaltender Maßnahmen ablehnt und diese Frage verneint.
Weil die Betroffene für ihre gegenwärtige Lebenssituation eine wirksame Patientenverfügung erstellt hatte, ist diese bindend: Die Gerichte sind damit nicht zur Genehmigung des Abbruchs der lebenserhaltenen Maßnahmen berufen, sondern hatten die eigene Entscheidung der Betroffenen zu akzeptieren und ein Negativattest zu erteilen.
Falle beim Wechsel der Krankenversicherung
Verbraucherzentrale warnt vor Lücke beim Anspruch auf Pflegegeld
Verbraucher, die von der privaten Krankenversicherung in die Familienversicherung der gesetzlichen Krankenversicherung wechseln, riskieren möglicherweise eine zweijährige Lücke bei der Pflegeversicherung, warnt die Verbraucherzentrale Hamburg. Das Bundessozialgericht hat in einem Urteil entschieden, dass erst nach zwei Jahren Vorversicherungszeit in der gesetzlichen Versicherung ein Anspruch auf Pflegegeld besteht. Die Verbraucherschützer raten Privatversicherten daher, wenn sie in die gesetzliche Familienversicherung wechseln, die Beiträge für die private Pflegeversicherung zunächst weiterzuzahlen (Urteil des Bundessozialgerichts vom 30. November 2017, Az. B 3 P 5/16 R).
„Mit dem Wechsel von der privaten in die gesetzliche Krankenversicherung wechseln Verbraucher auch automatisch von der privaten in die gesetzliche Pflegeversicherung“, erläutert Christoph Kranich von der Verbraucherzentrale Hamburg. Die gesetzliche Pflegeversicherung sei jedoch mit einer zweijährigen Wartezeit verbunden, in der Betroffene keine Leistungen erhalten. Der Experte empfiehlt Privatversicherten daher, nur die private Kranken-, nicht aber die private Pflegeversicherung zu kündigen, wenn sie in die Familienversicherung einer gesetzlichen Krankenkasse wechseln. Die private Pflegeversicherung sollten Verbraucher zwei Jahre lang weiter finanzieren, bis sie auch von der gesetzlichen Pflegeversicherung Leistungen erhalten. „Andernfalls kann es teuer werden. Wenn ausgerechnet in der zweijährigen Übergangszeit Pflege notwendig wird, müssen die Betroffenen dafür selbst aufkommen. Beim höchsten Pflegegrad 5 wäre das für die Dauer von zwei Jahren immerhin eine Summe von 50.000 Euro. Für die Weiterführung der privaten Pflegeversicherung fallen nach unseren Berechnungen im selben Zeitraum dagegen in den meisten Fällen weit weniger als 2.700 Euro an“, so Kranich.
Viele privat Krankenversicherte können im Alter die stark gestiegenen Beiträge für ihre Versicherung nicht mehr bezahlen. Doch ein Wechsel zur gesetzlichen Kasse ist dann nicht mehr ohne Weiteres möglich. „Wer allerdings mit einer gesetzlich krankenversicherten Person verheiratet ist oder mit dieser in einer eingetragenen Partnerschaft lebt, kann auf Dauer in die kostenlose Familienversicherung der gesetzlichen Kassen wechseln, wenn sein Einkommen weniger als 435 Euro pro Monat beträgt“, erklärt Kranich. Die Lücke in der Pflegeversicherung betrifft laut Kranich ausschließlich die Versicherten, die freiwillig in die Familienversicherung ihres Ehegatten oder Partners eintreten. Nicht betroffen sind Personen, die sich gezwungenermaßen gesetzlich versichern müssen.
„Fallstricke wie diesen gibt es zuhauf im Krankenversicherungssystem“, ärgert sich Kranich. „Es verstößt gegen jedes Gebot von Transparenz und Fairness, die Absicherung gegen Krankheit und Pflegebedarf so kompliziert auszugestalten, dass selbst Krankenkassen, Rechtsanwälte und Patientenberater diese Feinheiten nur schwerlich oder manchmal auch gar nicht kennen und verstehen.“
Krankenversicherung für Studenten
Privat oder lieber gesetzlich versichern? - Eine Entscheidung, die lange bindet.
Die Frage zum Krankenversicherungsschutz stellt sich den meisten Studenten erst zum Zeitpunkt der Immatrikulation. Doch gerade Studenten, die bisher – zum Beispiel durch die Eltern – privat versichert waren, sollten zum Studienbeginn genau überlegen, ob sie weiter privat versichert sein wollen oder der Wechsel in die gesetzliche Krankenversicherung der Studenten (KVdS) die bessere Alternative ist, rät die Verbraucherzentrale MV.
Für manche Studenten kann die Private Krankenversicherung sinnvoll sein. Wenn zum Beispiel über die verbeamteten Eltern ein Beihilfeanspruch besteht, ist die private Restkostenversicherung meistens günstiger als die gesetzliche KVdS. Studenten sollten sich vor der Wahl des Vertrages in jedem Fall über Vor- und Nachteile unabhängig beraten lassen. Denn fällt während des Studiums der Kindergeldanspruch weg, muss der private Krankenversicherungsvertrag auf hundertprozentigen Versicherungsschutz umgestellt werden. Das hat einen entsprechend hohen Beitrag zur Folge, der meistens über dem Niveau der gesetzlichen Krankenkasse liegt. Ist zu Beginn des Studiums die Wahl einmal getroffen, bleibt diese Entscheidung für die gesamte Studiendauer bindend.
Also Achtung: Wer sich privat versichert, kommt während des Studiums nicht mehr in die gesetzliche Krankenkasse zurück.
Bei gesetzlich versicherten Eltern ist der Studienanfänger bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres kostenfrei familienversichert. Diese Zeit verlängert sich bei geleistetem Wehr- bzw. Ersatzdienst entsprechend. Eine beitragsfreie Familienversicherung ist jedoch nur möglich, wenn das regelmäßige Einkommen des Studenten unter 435 Euro liegt bzw. bei einer geringfügigen Beschäftigung (Minijob) 450 Euro nicht überschreitet. In diesem Fall und ab dem 26. Lebensjahr ist dann aber eine studentische Versicherung möglich, so die Verbraucherzentrale MV.
Die beste Gesetzliche Krankenkasse finden?
Wie findet man eigentlich die für einen beste gesetzliche Krankenkasse? Welche Unterschiede gibt es bei den Anbietern? Kann man so einfach die Krankenkasse wechseln? Sehen Sie dazu die Antworten im Video-Interview von Verbraucherfinanzen-Deutschland.de und Thomas Adolph, Experte und Betreiber des Vergleichsportal für Gesetzliche Krankenkassen, kassensuche.de.