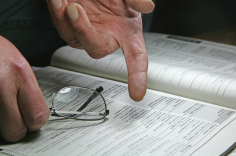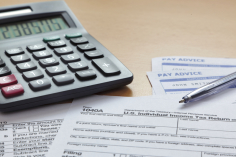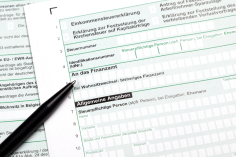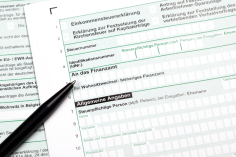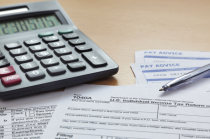Hochwasserschäden von der Steuer absetzen
Viele Häuser sind nach der Katastrophe unbewohnbar
Tief Orinoco brachte wiederholt Stark- und Dauerregen nach Deutschland. Die Niederschlagsmengen eines ganzen Monats kamen teilweise binnen weniger Stunden herunter und führten zu Dammbrüchen und Überflutungen von Wohngebieten in Südwest- und Süddeutschland. Das Ausmaß der Schäden ist noch nicht absehbar. Laut Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) werden rund 50 Prozent der Hochwasseropfer feststellen, dass sie keine Zusatzversicherung gegen Elementarschäden besitzen, die ihnen diese Schäden ersetzt. Doch es gibt die Möglichkeit, einen Teil der Ausgaben in der Steuererklärung geltend zu machen, so die Lohnsteuerhilfe Bayern.
Werbungskosten, Handwerker oder außergewöhnliche Belastungen?
Bei gemieteten Objekten ist für die Schäden am Gebäude der Vermieter zuständig. Private Vermieter können alle Kosten, die ihre Immobilie betreffen, als Werbungskosten absetzen. Reparaturleistungen, die den alten Zustand wiederherstellen, können sofort abgesetzt werden. Bauliche Maßnahmen, die den Zustand der Immobilie zu davor verbessern, erfordern eine mehrjährige Abschreibung. Unter Umständen ist eine Sonderabschreibung möglich, die in Katastrophenerlässen festgesetzt wird. Übernimmt eine Versicherung die Schäden, ist ein steuerlicher Abzug für diese Leistungen ausgeschlossen.
Für den durch die Fluten zerstörten Hausrat stehen Mietern hingegen die außergewöhnlichen Belastungen bei der Einkommensteuererklärung offen. Die Steuerexperten der Lohnsteuerhilfe Bayern weisen darauf hin, dass „sämtliche Wiederbeschaffungen und Instandsetzungen laut Gesetz notwendig, existenziell und in einem angemessenen Umfang sein müssen“. Das bedeutet, dass nur der Neukauf von grundlegenden Einrichtungs-, Elektro- und Haushaltsgegenständen sowie Kleidungsstücken vom Finanzamt anerkannt wird. Sehr teure Luxusmarken und Luxusgegenstände, wie Schmuck oder Kunstwerke, können nicht bei den außergewöhnlichen Belastungen berücksichtigt werden.
Selbiger Gesetzeswortlaut betrifft Eigenheimbesitzer ebenso. Instandsetzungen und Reparaturen werden nur an existenziell wichtigen Bereichen des Wohngebäudes vom Fiskus als außergewöhnliche Belastungen anerkannt. Ein Austausch der defekten Heizungsanlage oder der Kellerfenster kann z.B. problemlos geltend gemacht werden. Ausgeschlossen sind im Gegensatz dazu z.B. die Kosten für die Wiederherstellung einer Terrasse, des Gartens oder der Garage. Zahlungen von einer Versicherung, erhaltene Spendengelder oder steuerfreie Unterstützungen des Arbeitgebers sind von den abzugsfähigen Ausgaben abzuziehen. Zudem kürzen Finanzbeamte den angesetzten Betrag um die zumutbare Eigenbelastung, die bis zu sieben Prozent vom Bruttoeinkommen beträgt. Um außergewöhnliche Belastungen geltend zu machen, haben Steuerpflichtige bis zu drei Jahre nach der Katastrophe Zeit. Absetzungsfähige Reparaturen müssen in diesem Zeitraum abgeschlossen sein.
Sollten die Kosten für die Schadensbeseitigung und Instandsetzung die zumutbare Belastungsgrenze nicht übersteigen, so können viele Arbeiten wenigstens als Handwerker- oder haushaltsnahe Dienstleistung steuerlich in Abzug gebracht werden. Hier können die Kosten für Räumung, Entsorgung, Gutachten, Reparaturen und Wiederherstellung eingetragen werden, sofern sie von einer Firma erbracht und unbar bezahlt wurden. Liegen die Rechnungen vor, wird pauschal ein Fünftel der Arbeits-, Fahrt- und Maschinenkosten bis zu 1.200 Euro von der Steuerlast direkt für selbiges Jahr abgezogen.
Mehr Liquidität im Katastrophenfall
Die genannten Steuerentlastungen kommen frühestens im darauffolgenden Jahr nach der Abgabe einer Einkommensteuererklärung zum Tragen. Wer nicht so lange warten möchte, kann beim zuständigen Finanzamt einen Antrag auf Lohnsteuerermäßigung stellen. Die geschätzten außergewöhnliche Belastungen oder Werbungskosten werden dann als Freibetrag In den elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen eingetragen. Das hat zur Folge, dass monatlich weniger Lohnsteuer vom Gehalt abgezogen wird und sofort mehr Geld für den Schadensausgleich zur Verfügung steht. Ein Geldgeschenk vom Staat ist das aber nicht. Was es laufend mehr aufs Konto gibt, wird im Folgejahr von der Steuererstattung abgezogen.
Es kann sich auch lohnen, beim Arbeitgeber nach einer finanziellen Unterstützung aufgrund der Katastrophenschäden nachzufragen. Beihilfen sind bis zu 600 Euro steuerfrei. In besonderen Härtefällen, die auf manche Flutopfer zutrifft, darf der Betrag höher sein. Weiterhin sind zinslose Kredite durch den Arbeitgeber nicht unüblich. Dieser kann betroffenen Angestellten auch vorübergehend unentgeltlich eine Wohnung oder Fahrzeug zur Verfügung stellen. Diese Unterstützungsleistungen sind ebenfalls steuerfrei, so die Lohnsteuerhilfe Bayern.
Steuererklärung: Ist jetzt die beste Zeit zum Abgeben?
Wer schnell seinen Steuerbescheid für das vergangene Jahr haben möchte, kann jetzt schon die Steuererklärung 2023 abgeben. In der Regel schickt das Finanzamt den Bescheid aber nicht vor Ende März. Warum ist das so? Lässt sich die Bearbeitung beschleunigen? Und bis wann muss die Steuererklärung 2023 spätestens beim zuständigen Finanzamt sein? Antworten darauf gibt der Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH).
Lässt sich die Bearbeitung der Steuererklärung beschleunigen?
Rein theoretisch kann die Einkommensteuererklärung für das jeweils zurückliegende Jahr bereits am 1. Januar des darauffolgenden Jahres abgegeben werden. Doch so zeitig dran sind die wenigsten Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Allzu lange wollen viele aber auch nicht warten und geben ihre Steuererklärung deshalb früh ab. Entweder weil sie mit einer Steuerrückerstattung rechnen und das Geld gerne zügig auf ihrem Konto hätten. Oder weil sie von einer Steuernachzahlung ausgehen und diese schnell aus dem Kreuz haben möchten.
Mit diesen drei Tipps erhöhen sich die Chancen, dass die Steuererklärung zügig bearbeitet wird:
Wer zuerst kommt, mahlt zuerst: Die Steuererklärung so früh wie möglich abgeben. Denn das Finanzamt bearbeitet Steuererklärungen nach Eingang, zumindest ab März.
Digital geht vor analog: Die Steuererklärung elektronisch per ELSTER an das Finanzamt übermitteln. Denn diese Steuererklärungen erfordern meist weniger Aufwand als solche, die in Papierform kommen. "Viele ELSTER-Erklärungen werden beim Finanzamt mittlerweile sogar vollautomatisch bearbeitet. Für diese gibt es den Steuerbescheid besonders schnell", weiß VLH-Vorstand Uwe Rauhöft.
Schnelle Reaktion bei Rückfragen: Nachweise, Quittungen und Belege griffbereit halten. Denn dann können Steuerpflichtige schnell reagieren, falls das Finanzamt Nachfragen hat beziehungsweise um Nachweise bittet.
Wann ist frühestens mit dem Steuerbescheid zu rechnen?
Zum Jahresbeginn müssen in den Finanzämtern erst einmal aktuelle Steuerrechtsänderungen in die Software eingespeist werden. Zudem warten die Finanzämter zunächst auf die Steuerdaten, die von Arbeitgebenden oder auch Versicherungen elektronisch übermittelt werden. Das muss bis Ende Februar geschehen sein. Erst dann werden Steuererklärungen für das Jahr 2023 abgearbeitet. Dadurch können Steuerzahlerinnen und Steuerzahler in der Regel erst ab Ende März mit ihrem Steuerbescheid rechnen, selbst wenn sie ihre Steuererklärung bereits im Januar abgegeben haben.
Wie lange darf sich das Finanzamt Zeit lassen?
Grundsätzlich müssen mehrere Wochen Wartezeit nach Abgabe der Steuererklärung eingeplant werden, ehe der Steuerbescheid eintrudelt. Die schnellsten Finanzämter hatte im Jahr 2023 das Bundesland Rheinland-Pfalz. Diese benötigten im Schnitt 49,87 Tage für die Bearbeitung einer Einkommensteuererklärung. Beinahe ebenso schnell waren die Finanzämter in Hamburg (50,01 Tage) und Nordrhein-Westfalen (50,06 Tage). Schlusslicht war Brandenburg: Dort wartete man im Schnitt 68,85 Tage auf den Steuerbescheid. Die Liste der schnellsten Finanzämter in der Einzelbetrachtung führt das Finanzamt Herne mit 29,8 Tagen an. (Quelle: https://www.lohnsteuer-kompakt.de/start/finanzaemter)
Grundsätzlich gibt es keine offizielle Vorgabe, in welchem zeitlichen Rahmen das Finanzamt eine Steuererklärung bearbeiten muss. Wartet eine Steuerzahlerin oder ein Steuerzahler aber drei Monate auf den Bescheid, kann sie oder er beim zuständigen Finanzamt durchaus nachfragen. Das geht schriftlich oder noch besser in einem kurzen Telefonat, dabei lässt sich vieles klären.
Abgabefrist für die Steuererklärung 2023
Während die Finanzämter keine gesetzlich geregelte Frist für die Bearbeitung einer Steuererklärung einhalten müssen, sieht es für Steuerzahlerinnen und Steuerzahler anders aus. Zumindest für diejenigen, die zur Abgabe einer Steuererklärung verpflichtet sind: Sie müssen die Steuererklärung 2023 bis zum 2. September 2024 abgegeben haben. Offizieller Stichtag ist zwar der 31. August, da es sich dabei aber um einen Samstag handelt, bleibt Zeit bis zum darauffolgenden Montag.
Wer seine Steuererklärung 2023 von einem Lohnsteuerhilfeverein oder einem Steuerberater beziehungsweise einer Steuerberaterin erstellen lässt, hat länger Zeit: In diesem Fall muss sie erst am 2. Juni 2025 beim Finanzamt sein. Auch hier fällt der offizielle Stichtag auf einen Samstag (31. Mai), deshalb reicht die Abgabe bis zum darauffolgenden Montag.
Übrigens: Bei Bürgerinnen und Bürgern, die eine Steuererklärung abgeben müssen, handelt es sich um eine Pflichtveranlagung. Die freiwillige Abgabe nennt sich Antragsveranlagung - und eine solche ist bis zu vier Jahre rückwirkend möglich, so der VLH.
.
Die wichtigsten Änderungen 2024 bei Steuern und Finanzen
Mehr Geld auf dem Konto und höhere Ausgaben
Ein neues Jahr bringt meist Veränderungen mit sich. Dazu zählen die gesetzlichen Überarbeitungen, die sich im täglichen Leben auf die finanzielle Situation auswirken. Im Einkommensteuerbereich und bei der Familienförderung kommt es inflationsbedingt zu positiven Anpassungen. Im Gegenzug wird aufgrund des angespannten Bundeshaushalts und zur Erreichung der Klimaschutzziele das Leben für die Verbraucher aufgrund von Steueranhebungen teurer. Die Lohi (Lohnsteuerhilfe Bayern) gibt einen Überblick über die Änderungen, die sich am meisten auf das Budget der Haushalte in Deutschland auswirken.
Senkungen beim Einkommensteuertarif
Nach dem Inflationsausgleichgesetz von 2022 stieg der steuerliche Grundfreibetrag von 10.908 auf 11.604 Euro pro Person an. Erst ab dieser Einkommenshöhe werden Steuern fällig. Verheiratete profitieren vom doppelten Grundfreibetrag von derzeit 23.208 Euro, unabhängig davon, ob beide Ehegatten berufstätig sind. Die Freigrenze für den Soli steigt auf 18.130 Euro. Er wird erst ab einer Einkommensteuerlast in dieser Höhe für Besserverdiener fällig.
Die Bundesregierung ist derzeit im Gespräch, den Grundfreibetrag auf 11.784 Euro rückwirkend zum 1. Januar 2024 nochmal anzuheben. Hierzu ist aber vieles unklar und die Regierung wird überlegen müssen, wie das finanziert werden kann.
Neue Förderhöhen für Familien
Der Kinderfreibetrag wurde für das Jahr 2024 von 6.024 auf 6.384 Euro pro Kind für beide Elternteile zusammen angehoben. Aufgrund der hohen Inflation und der Anhebung des Bürgergelds fällt das Plus größer aus. Getrennte Eltern erhalten jeweils den halben Kinderfreibetrag in Höhe von 3.192 Euro.
Darüber hinaus gibt es noch einen Freibetrag für den Betreuungs- und Erziehungs- oder Ausbildungsbedarf eines Kindes in Höhe von 2.928 Euro, bzw. 1.464 Euro je Elternteil, der unverändert bleibt.
Als zusätzliche finanzielle Unterstützung für Eltern mit geringem Einkommen gibt es noch eine Erhöhung des Kinderzuschlags. Dieser beträgt ab diesem Jahr 292 Euro monatlich je Kind, was ein monatliches Plus von 42 Euro im Vergleich zum Vorjahr ergibt.
Änderungen beim Elterngeld
Für Eltern, deren Kinder nach dem 1. April 2024 auf die Welt kommen, wird die Einkommensgrenze, die den Anspruch auf Elterngeld begründet, von 300.000 Euro auf 200.000 Euro zu versteuerndes gesenkt. Für Alleinerziehende folgt eine Senkung der Elterngeldgrenze auf 150.000 Euro ab April dieses Jahres. Eltern mit sehr hohen Einkünften werden also nicht mit Elterngeld unterstützt.
Zudem werden die Partnermonate neu geregelt. Eine Aufstockung von zwölf auf vierzehn Monate Elternzeit ist zwar nach wie vor möglich, aber die gemeinsame Elternzeit beider Elternteile wird auf einen Monat reduziert. Das bedeutet, dass sich die Eltern die Kindesbetreuung ab jetzt mehr aufteilen und getrennt wahrnehmen müssen.
Gestiegene Beitragsbemessungsgrenzen
Für sozialversicherungspflichtige Angestellte sind die Beitragsbemessungsgrenzen bei der gesetzlichen Renten- und Arbeitslosenversicherung angehoben worden. Beiträge werden in Westdeutschland nun bis zu einem Monatsgehalt von 7.550 Euro und in Ostdeutschland bis 7.450 Euro pro Monat fällig. Somit erhöhen sich die Sozialabgaben für Besserverdiener. Der Beitragssatz bleibt aber mit 18,6 Prozent konstant.
Bei der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung liegt die neue Beitragsbemessungsgrenze seit 1. Januar bundeseinheitlich bei 5.175 Euro. Die Pflicht, sich gesetzlich krankenzuversichern, hört jetzt bei einem Jahreseinkommen von 69.300 Euro auf. Bei einem höheren Jahreseinkommen steht es frei, sich privat krankenzuversichern.
Steigende Lebenshaltungskosten in 2024
Seit 1. Januar sind Restaurantbesuche teurer, denn in der Gastronomie gilt wieder eine Mehrwertsteuer von 19 Prozent. Der reduzierte Mehrwertsteuersatz von sieben Prozent auf Speisen, der seit der Corona-Pandemie griff, wurde aufgehoben. Gastronomen und Verbraucher befürchten infolge der Verteuerungen einen Rückgang des Außerhauskonsums, der Lokalschließungen nach sich ziehen könnte.
Weiterhin ist der CO2-Preis von 30 auf 45 Euro je Tonne ausgestoßenen Kohlendioxids erhöht worden. Das verteuert nicht nur Diesel und Benzin beim Tanken direkt, sondern auch die Heizkosten für Gas- und Ölheizungen erheblich. Auch beim Strompreis muss dadurch mit höheren Netzentgelten gerechnet werden. Zusätzlich ist mit Ende Dezember 2023 die Preisbremse für Strom, Gas und Fernwärme vorzeitig gestrichen worden. Wohnen und Fahrten zur Arbeit belasten das Haushaltsbudget somit deutlich stärker.
Dazu kommt, dass Urlaubsreisen mit dem Flugzeug neben den gestiegenen Kerosinkostenaufgrund der Ticketsteuer, die ab Mai um circa 19 Prozent ansteigt, teurer werden.
Neben den erhöhten Spritkosten greift ab Juli eine Mautpflicht für Kleintransporter mit mehr als 3,5 Tonnen. Seit 1. Dezember 2023 müssen Lastwägen auf deutschen Fernstraßen 200 Euro je Tonne freigesetzten Kohlendioxids als Aufschlag zur Maut entrichten. Die gestiegenen Transportkosten werden sich mit hoher Wahrscheinlichkeit auf Lebensmittel und andere Konsumgüter auswirken und diese ebenfalls verteuern, so die Lohi.
Steuern leicht gemacht: die Unterlagen-Checkliste für 2023
Die Lohnsteuerhilfe Bayerni macht das Steuerleben leichter
Für das Anfertigen einer Steuererklärung werden Unmengen an Nachweisen benötigt. Damit das Zusammensuchen für das Jahr 2023 schneller, einfacher und komfortabler gelingt, bieten wir die Steuer-Checkliste an. Mit dieser können Sie strukturiert Ihre Unterlagen zusammentragen und behalten jederzeit den vollen Überblick.
Für ein Beratungsgespräch bei der Lohi gibt es zudem keine bessere Vorbereitung. Laden Sie die kostenlose Checkliste für 2023 einfach herunter und haken Sie Punkt für Punkt darauf ab. Alle Papiere, die auf Sie zutreffen, bringen Sie optimalerweise Ihrem Steuerexperten mit. So kann dieser mit Leichtigkeit das maximal mögliche an Steuern für Sie zurückholen! Unser Auftrag – Ihr Vorteil.
Hier geht es zum kostenlosen Download: Checkliste für die Einkommensteuer 2023 https://www.lohi.de/fileadmin/lohi/pdf/2023_Checkliste_Unterlagen_Einkommensteuererklaerung.pdf
Duales Studium: Ausbildungsgehalt mit Steuervorteil
Ein duales Studium hat viele Vorteile
Studieren und gleichzeitig Praxiserfahrung im Unternehmen sammeln, liegt stark im Trend, berichtet die Lohnsteuerhilfe Bayern. Immer mehr Abiturienten entscheiden sich für ein duales Studium. Waren es im Jahr 2014 noch 95.000 Studierende in dualen Studiengängen, so stieg die Zahl im Jahr 2022 auf 120.500 an. Meist ist der Bachelor an einer Hochschule, kombiniert mit einem Berufsabschluss, das Ziel. Neben der Vorbereitung auf das eigentliche Arbeitsleben und der Integration in ein Unternehmen mit Aussicht auf einen Arbeitsplatz ist die feste Vergütung während des Studiums ein großer Vorteil.
Aber nicht nur das Gehalt unterscheidet das duale Studium von einem rein wissenschaftlich ausgelegten Studium an einer Universität, denn im Gegensatz zu Studierenden im Erststudium können dual Studierende weitreichende Steuervorteile nutzen.
Das duale Studium ist überlegen
Studierenden im Bachelorstudiengang und außerbetrieblichen Auszubildenden in der ersten Berufsausbildung steht für ihre Ausbildungskosten lediglich der Sonderausgabenabzug offen. Doch in der Praxis bringt dieser den jungen Menschen regelmäßig keinen Cent, weil demgegenüber keine oder niedrige Einkünfte stehen. Auch ist bei den Sonderausgaben kein Verlustvortrag möglich, denn die angefallenen Kosten können leider ausschließlich mit der Steuerlast im selben Jahr verrechnet werden. Während die einen leer ausgehen, können die dual Studierenden auf der anderen Seite mit Steuervorteilen rechnen.
Das duale Studium erfolgt im Rahmen eines Ausbildungsdienstverhältnisses mit einem Betrieb. Der Betrieb stellt üblicherweise laut Ausbildungsvertrag für den Zeitraum der gesamten Ausbildung die erste Tätigkeitsstätte dar. Somit können dual Studierende genau wie alle anderen Arbeitnehmenden sämtliche Ausgaben unbegrenzt als Werbungskosten in der Steuererklärung ansetzen. Zu den Werbungskosten zählen alle Aufwendungen, die für das duale Studium anfallen und nachgewiesen werden können. Daher sollten sämtliche Belege aufgehoben werden. Die Tatsache, dass es sich um eine Erstausbildung handelt, ist hier kein Hindernis.
Von Fahrtkosten über Reisekosten
Für die Fahrten von der Wohnung zum Betrieb können die übliche Entfernungspauschale oder die Kosten für die öffentlichen Verkehrsmittel geltend gemacht werden. Die Fahrten zur Hochschule zählen indes als Auswärtstätigkeit. Das heißt, es können Reisekosten und bei entsprechender Aufenthaltsdauer die Verpflegungspauschale angesetzt werden. Liegen Studienort und Ausbildungsbetrieb so weit auseinander, dass für die Hochschulsemester eine Zweitwohnung notwendig ist, können noch Übernachtungskosten für die ersten drei Monate steuerlich berücksichtigt werden. Nach einer Unterbrechung von vier Wochen beginnt die Dreimonatsfrist sogar von vorne. Dies gilt auch für betriebliche Lehrgänge außerhalb des Betriebes.
Zu Studienbeginn fallen viele Ausgaben an
Zu den typischen Werbungskosten von Studierenden zählen Arbeitsmittel. Gerade zu Studienbeginn besteht hier ein hoher Bedarf. Werden für das Studium ein leistungsfähiger PC, Laptop oder Tablet, Drucker, Software, Taschenrechner, ein Internetanschluss, Bücherregal oder Schreibtisch benötigt, lassen sich diese Ausgaben absetzen. Auch Büromaterial, Druckerpapier, Fachliteratur, spezielle Berufsbekleidung oder Werkzeuge für den praktischen Teil im Betrieb werden anerkannt. Abziehbar sind alle selbst getragenen Ausgaben, nicht aber diejenigen, die vom Arbeitgeber übernommen wurden.
Nicht zu vergessen sind die Bewerbungskosten im Vorfeld für den dualen Studiengang sowie Kopiergeld, Druck- und Bindekosten für die Abschlussarbeit. Ist ein Auslandsaufenthalt oder -semester verpflichtend, reduzieren diese erhöhten Kosten die Steuerlast durch den Reisekostenansatz enorm. Für Umzüge aufgrund des Studiums kann eine Umzugskostenpauschale in Höhe von 177 Euro geltend gemacht werden, sofern vorher der einzige Hausstand im Elternhaus gegeben war. Neben den speziellen Ausbildungskosten sind natürlich auch noch die üblichen Posten von Arbeitnehmenden, wie z.B. bestimmte Versicherungsausgaben und Kontoführungsgebühren, in der Steuererklärung anzubringen, so die Lohnsteuerhilfe Bayern.
Steuererklärung: Finanzamt geht vor Datenschutz
Um die Einkommensteuererklärung prüfen zu können, benötigt das Finanzamt oft personenbezogene Daten – auch von unbeteiligten Dritten. Das ist erlaubt, wie das Finanzgericht Nürnberg 2023 entschieden hat, denn die Aufgaben des Finanzamtes stehen im öffentlichen Interesse und damit über den Datenschutzanliegen einer einzelnen Person. Der Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe e.V. (VLH) erklärt, was das konkret bedeutet.
Steuererklärung: Finanzamt geht vor DatenschutzWer staatliche Leistungen wie beispielsweise Bürgergeld oder Kinderzuschlag erhalten will, genauso wer bestimmte Kosten beim Finanzamt geltend machen möchte, muss seine finanziellen Verhältnisse darlegen.
Heißt: Sämtliche Einnahmen und Vermögenswerte müssen korrekt offengelegt werden. Dazu zählt auch ein Mietvertrag inklusive der Konditionen und Kontaktdaten von Mietern, wie das Finanzgericht Nürnburg 2023 entschieden hat (Aktenzeichen 3 K 596/22).
Öffentliches Anliegen wichtiger als persönliches Interesse
Im konkreten Fall wollte ein Vermieter für die Erstellung seiner Einkommensteuererklärung die Namen und Mietverträge seiner Mieter/innen nicht offenbaren – aus Datenschutzgründen. Das Finanzamt bestand aber auf die Offenlegung und das Gericht gab dem Amt Recht.
Die Begründung: "Ein Steuerpflichtiger [ist] nach § 90 Abs. 1 AO zur Mitwirkung bei der Ermittlung des Sachverhalts verpflichtet." Er komme dieser Mitwirkungspflicht dadurch nach, indem er die für die Besteuerung nötigen Tatsachen vollständig und wahrheitsgemäß offenlege und die ihm bekannten Beweismittel angebe. Welche Daten dafür eine Rolle spielen und was dabei offengelegt werden muss, liege im Ermessen des Finanzamts. Der Vermieter ist nun in Revision gegangen und das Verfahren ist beim Bundesfinanzhof (BFH) anhängig (Aktenzeichen IX R 6/23).
Einschätzung der VLH: Die Chancen auf eine Entscheidung im Sinne des Vermieters stehen nicht gut. Der Grund: Das Finanzamt ist an das Steuergeheimnis gebunden. Das bedeutet, dass die in den Mietverträgen enthaltenen Daten für die Erstellung der Einkommensteuererklärung des Klägers genutzt werden dürfen – aber nicht darüber hinaus. Somit bleibt der Datentransfer datenschutzkonform. Lediglich ein/e Finanzbeamter/in ist über die Daten informiert – er/sie arbeitet im öffentlichen Interesse und benötigt die Daten zur Wahrung seiner/ihrer Aufgabe.
Finanzamt will Bankgeheimnis umgehen
Anders sieht es hingegen in folgendem Fall aus (Aktenzeichen IX R 32/21): Das Finanzamt hat die Bank eines Steuerpflichtigen angeschrieben, um an dessen Kontoauszüge zu gelangen. Deren Herausgabe hatte der Mann zuvor verweigert. Ob das Finanzamt die Bank zurecht kontaktiert hat, muss nun ebenfalls der Bundesfinanzhof entscheiden. Denn in Deutschland gilt das Bankgeheimnis. Welches Interesse hier nun höher wiegt, liegt in der Entscheidung der BFH-Richter/innen, so der VLH.
Kapitaleinkünfte: Verlustausgleich zwischen Ehegatten jetzt erlaubt
Ehegatten können sich über die neue Gesetzeslage freuen
Die Ehe ist in Deutschland durch das Grundgesetz geschützt. Damit verbunden sind auch Steuervorteile. Als Ehepaar kann man sich zusammen veranlagen lassen und so weniger Steuern zahlen. Jedoch hat das Einkommensteuergesetz Lücken. Beispielsweise gab es bisher keine gesetzliche Grundlage für eine Verrechnung von Verlusten und Gewinnen aus Kapitaleinkünften zwischen Ehegatten. Die Einkünfte aus Aktien oder Wertpapieren der einzelnen Ehegatten wurden jeweils getrennt ermittelt und nur mit deren eigenen Kapitalerträgen verrechnet. Das Jahressteuergesetz 2022 hat hier nun eingegriffen und Klarheit für Eheleute geschaffen, berichtet die Lohnsteuerhilfe Bayern.
Bisherige Ausnahme: gemeinsamer Freistellungsauftrag
Ehegatten und eingetragene Lebenspartnerschaften, die zur Zusammenveranlagung berechtigt und bei ein und derselben Bank Kunden sind, konnten bereits seit dem Jahr 2010 mit einem gemeinsamen Freistellungsauftrag eine Verlustverrechnung zum Jahresende erreichen. In diesem Fall haben die Geldinstitute die Gewinne und Verluste über alle dort einzeln oder gemeinschaftlich geführten Konten und Depots automatisch zwischen Ehegatten verrechnet.
Nicht möglich war jedoch ein nachträglicher Verlustausgleich im Zuge der Steuererklärung, wenn kein gemeinsamer Freistellungsauftrag vorliegt oder die Depots bei verschiedenen Geldinstituten unterhalten werden. Hatte der eine Ehegatte auf seine Gewinne Abgeltungssteuer abführen müssen, so konnte diese nicht durch die Verluste des anderen Ehegatten gesenkt oder ausgeglichen werden. Dafür fehlte die gesetzliche Grundlage, wie der Bundesfinanzhof im November 2021 feststellte.
Die Ergänzung im Einkommensteuergesetz
Mit dem Jahressteuergesetz 2022 wurde dieses Manko behoben. Die ehegattenübergreifende Verlustverrechnung von Kapitaleinkünften derselben Art ist nicht erst ab dem Steuerjahr 2023, sondern schon für das Veranlagungsjahr 2022 rückwirkend möglich. Gesetzesgrundlage bildet die Ergänzung des § 20 Abs. 6 Satz 3 im Einkommensteuergesetz.
Damit dies in der Praxis umgesetzt werden kann, benötigen Ehegatten, die eigene Depots führen, eine Jahressteuerbescheinigung von ihrer Depotbank. Die auf dieser Bescheinigung aufgeführten nicht ausgeglichenen Verluste können ab sofort im Rahmen der Einkommensteuererklärung finanztechnisch festgestellt und mit positiven Erträgen des Ehepartners steuersparend verrechnet werden. Dies kann zu einer Gutschrift führen, wenn zuvor vom Geldinstitut Kapitalertragsteuer, Kirchensteuer und Soli für die Gewinne eines Ehepartners eingezogen wurden, so die Lohnsteuerhilfe Bayern.
Mehr Durchblick mit der neuen Steuer-Checkliste
Steuer Checkliste Unterlagen
Alle Jahre wieder werden unzählige Unterlagen für das Anfertigen der Steuererklärung benötigt. Und oftmals bleibt ein Gefühl der Unsicherheit irgendetwas vergessen zu haben und deswegen Geld zu verschenken zurück. Die aktualisierte Steuer-Checkliste der Lohi dagegen bringt das gute Gefühl, alles im Blick zu haben.
Für ein Beratungsgespräch bei der Lohi sind Sie mit dieser Checkliste zudem ideal vorbereitet. Bringen Sie dafür die für die zutreffenden Unterlagen einfach zur Lohi mit. Um alles andere kümmert sich dann Ihr Lohi-Berater. Er teilt Ihnen mit, falls weitere Nachweise und Belege in Ihrem Fall nützlich sind, damit für Sie die maximale Steuerrückzahlung herausspringt.
Jetzt aber erstmal die kostenlose Steuer-Checkliste für das Jahr 2022 downloaden und einzelnen Punkte auf der Liste nacheinander durchgehen und abhaken.
Hier geht es zur Checkliste für die Einkommensteuer 2022 https://www.lohi.de/fileadmin/lohi/pdf/2022_Checkliste_Unterlagen_Einkommensteuererklaerung.pdf
Finanzämter versenden derzeit massenhaft Zinsfestsetzungsbescheide
Ausgezahlte Erstattungszinsen müssen nicht zurückgezahlt werden
Die Steuerzahler in Bayern erhalten als erste seit Mitte November die Zinsfestsetzungsbescheide, in denen die Steuerzinsen nun verfassungskonform festgesetzt wurden. Hintergrund ist, dass das Bundesverfassungsgericht im Juli 2021 den Zinssatz von 0,5 Prozent monatlich und damit sechs Prozent jährlich für die Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen als verfassungswidrig erklärt hat. Da der neue Zinssatz erst festgelegt werden musste und die technische Umsetzung bei den Finanzämtern nicht umgehend möglich war, wurden die Zinsen übergangsweise vorläufig nicht mehr festgesetzt. Jetzt rollt eine Welle von Bescheiden auf die Steuerzahler zu, so die Lohnsteuerhilfe Bayern.
Warum werden so viele Zinsfestsetzungsbescheide erlassen?
Mit der Vielzahl an Zinsbescheiden werden die neuen gesetzlich fixierten Zinsen von 0,15 Prozent pro Monat (das macht nur mehr 1,8 Prozent pro Jahr) für die Verzinsungszeiträume ab dem 01.01.2019 rückwirkend festgesetzt. Die anderen Bundesländer werden Schritt für Schritt bis Mai 2023 folgen.
Aber Achtung, der Verzinsungszeitraum deckt sich nicht mit dem Veranlagungszeitraum, dem Kalenderjahr, für das eine Steuer festgesetzt wird. Die Verzinsung tritt sowohl im Erstattungs- als auch im Nachzahlungsfall erst später, genauer gesagt 15 Monate nach Ablauf des Kalenderjahrs, in dem die Steuer entstanden ist, ein. Die Lohnsteuerhilfe Bayern erklärt, welche Arten von Zinsfestsetzungsbescheiden bisher gesichtet wurden und wie Steuerzahler darauf reagieren sollten.
Mit welchen Arten von Zinsfestsetzungsbescheiden ist zu rechnen?
Im Bundesland Bayern konnte folgende Vorgehensweise festgestellt werden: Zuerst wurden solche Fälle versandt, in denen keine Festsetzung erfolgte. Danach kamen die Nachzahlungsbescheide und zum Schluss die Erstattungsbescheide. Ob die Vorgehensweise in den anderen Bundesländern dieselbe sein wird, ist noch unklar.
Die Berechnung mit den neuen Zinssätzen ergibt einen konkreten Zinsbetrag. Liegt dieser unter zehn Euro, werden die Zinsen nicht festgesetzt. In diesem Fall ergeht vom Finanzamt ein Bescheid über null Euro. Erst bei Beträgen über zehn Euro kommt es zu einer Nachzahlungsforderung oder Erstattung. Letztere sollte in jedem Fall ein Grund zur Freude sein, auch wenn die Verzinsung ab jetzt niedriger als bisher ausfällt.
Es muss aber nicht tatsächlich zu einer Auszahlung kommen. Denn die Finanzämter können die Zinszahlungen z.B. mit einer offenen Steuerzahlung verrechnen. Wurde auf dem Zinsfestsetzungsbescheid nicht explizit angegeben, womit eine Verrechnung erfolgt, wird in nächster Zeit ein Extra-Schreiben der Finanzkasse zugestellt. Diese Verrechnungs- oder Umbuchungsmitteilung enthält die Informationen über die Verrechnung einzelner Beträge. Der Grund für die Verrechnung der Zinsen muss von den Finanzämtern in jedem Fall mitgeteilt werden.
Wie sollten Steuerzahler im Fall einer Nachzahlung reagieren?
Kommt es zu einer Nachzahlungsaufforderung, sollte der Bescheid dahingehend überprüft werden, ob es sich um eine erstmalige oder geänderte Festsetzung handelt. Bei einer Erstfestsetzung sollte der Betrag innerhalb des angegebenen Zeitraums auf das angegebene Konto des Finanzamtes überwiesen werden. Dabei sind im Verwendungszweck die Steuernummer und das Datum des Zinsfestsetzungsbescheids anzugeben, damit das Finanzamt die Buchung zuordnen kann. Immerhin, durch die Absenkung des Zinssatzes sind wenigsten geringere Zinsen zu entrichten als bisher.
Sollte das Finanzamt im Rahmen einer Änderungsfestsetzung bereits ausgezahlte Erstattungszinsen zurückfordern, kann dagegen ein Einspruch eingelegt werden. Mitgliedern der Lohnsteuerhilfe Bayern wird dies automatisch abgenommen. Denn aus Gründen des Vertrauensschutzes dürfen keine festgesetzten und ausgezahlten Erstattungszinsen zurückgefordert werden. Wer in der Vergangenheit die Zinsen zu einem höheren Zinssatz schon kassiert hat, darf nachträglich also nicht schlechter gestellt werden und muss nichts davon zurückzahlen, so die Lohnsteuerhilfe Bayern.
Fast 30 Millionen Deutsche machen ihre Steuererklärung online
Viele schieben sie auf die lange Bank, doch in den meisten Fällen lohnt sie sich – die Steuererklärung. Inzwischen erledigt die Mehrheit der Steuerpflichtigen diese online. Das galt zuletzt für 54 Prozent derjenigen, die schon einmal eine Einkommensteuererklärung abgegeben haben – das sind knapp 30 Millionen Bundesbürgerinnen und Bundesbürger. Gut ein Fünftel (22 Prozent) nutzte dazu „Elster“, das kostenlose Steuer-Programm der Finanzverwaltung. 28 Prozent nutzten eine kommerzielle Steuer-Software für den PC und vier Prozent machten ihre letzte Steuererklärung auf dem Smartphone über eine Steuer-App. Das zeigt eine repräsentative Befragung unter mehr als 1.000 Personen ab 16 Jahren in Deutschland, die im Auftrag des Digitalverbands Bitkom durchgeführt wurde. „Die elektronische Einkommensteuererklärung ist ein Paradebeispiel für die Digitalisierung der Verwaltung“, sagt Bitkom-Hauptgeschäftsführer Dr. Bernhard Rohleder. Derzeit wird der digitale Weg zum Standard, denn die Finanzverwaltung akzeptiert ab dem Steuerjahr 2021 die Papierabgabe nur noch in Einzelfällen. Für viele Menschen bedeutet dies eine Umstellung: Drei von zehn (30 Prozent) Bundesbürgerinnen und -bürgern, die schon einmal eine Steuererklärung abgegeben haben, nutzten zuletzt noch das Papierformular. Weitere 13 Prozent überließen die Arbeit einer Steuerberatung. „Steuerpflichtige können auf eine Vielzahl digitaler Lösungen zurückgreifen. Kommerzielle Anbieter setzen dabei besonders auf Nutzerfreundlichkeit und geben – anders als das Programm Elster – zusätzlich Steuertipps“, so Rohleder.
In diesem Jahr wollen 77 Prozent der Menschen in Deutschland eine Einkommensteuererklärung abgeben oder haben dies bereits getan. Für neun Prozent von ihnen handelt es sich dabei um ihre erste Steuererklärung überhaupt. Insgesamt haben vier von fünf (81 Prozent) Menschen in Deutschland schon einmal eine Einkommensteuererklärung abgegeben, unter den Jüngeren zwischen 16 und 29 Jahren sind es 53 Prozent.
Abgabefrist Ende Oktober – Homeoffice kann pauschal abgesetzt werden
Wie bereits im Vorjahr wird die Frist für die Abgabe der Steuererklärung erneut verlängert. Steuerpflichtige, die sich nicht von einer Steuerberatung oder einem Lohnsteuerverein beraten lassen, können ihre Steuererklärung für das Steuerjahr 2021 bis zum 31. Oktober 2022 abgeben. Für die kommenden Steuerjahre wurden die Erklärungsfristen ebenfalls verlängert und enden am 30. September 2023 bzw. am 31. August 2024. Im Falle der steuerlichen Beratung endete die Abgabefrist für das Steuerjahr 2021 am 31. August 2022.
Aufgrund der Corona-Pandemie gibt es erneut Steuererleichterungen, die dazu anregen, auch auf freiwilliger Basis eine Steuererklärung abzugeben. Durch das vierte Corona-Steuerhilfegesetz wurden u.a. die Regelungen zur Homeoffice-Pauschale bis zum 31. Dezember 2022 verlängert. So können Steuerpflichtige pro Tag pauschal fünf Euro (max. 600 Euro im Jahr) absetzen, auch wenn sie zum Beispiel am Küchentisch arbeiten und kein spezielles häusliches Arbeitszimmer haben. Auch die „Corona-Boni“, also Arbeitgeberzuschüsse zum Kurzarbeitergeld, wurden für den Auszahlungszeitraum ab dem 18. November 2021 erhöht und blieben sechs Monate länger – bis Juni 2022 – steuerfrei. Alle Infos zu den Änderungen hat das Bundesfinanzministerium in einer FAQ-Liste zusammengefasst.
Vereinfachte Steuererklärung für Rente und Pension
Zur Durchführung der elektronischen Steuererklärung stellt die Finanzverwaltung das Online-Portal „Mein Elster“ bereit. Nach einmaliger Registrierung und postalischer Authentifizierung kann der Dienst genutzt werden – ohne Download und Installation einer Software. Für alle, die Rente oder Pension erhalten und eine Einkommenssteuererklärung abgeben, gibt es das Portal „einfachElster“, das die Abgabe wesentlich erleichtern soll. Hier müssen Informationen, die dem Finanzamt bereits vorliegen, wie Renten-bzw. Pensionseinkünfte und Daten zu Kranken- und Pflegeversicherung nicht mehr in eine Steuererklärung eingetragen werden. Es sind lediglich Fragen zu Angaben wie Spenden, Arztrechnungen, Behinderungen oder Handwerkerkosten zu beantworten.
Mehr als 800.000 Euro: So viele Steuern zahlen Deutsche in ihrem Leben
Es ist wieder soweit: Der Steuerzahlergedenktag fällt dieses Jahr auf den 13. Juli. Wenn es nach dem Bund der Steuerzahler e.V. geht, beginnen wir erst in der zweiten Hälfte des Jahres für den eigenen Kontostand zu arbeiten. Für die einen ist die Steuerbelastung im internationalen Vergleich ein Skandal, andere sehen darin einen starken Sozialstaat. WeltSparen, die Plattform für Geldanlage, hat berechnet, wie viel die Deutschen über ihr gesamtes Leben hinweg an Steuern und Abgaben zahlen und welche Leistungen der Staat dafür erbringt.
Ein Versuch, die Lebensleistung der Deutschen in Zahlen zu fassen – rein finanziell natürlich. Studienseite: https://www.weltsparen.de/steuer/steuern-sparen/#so-viele-steuern-und-abgaben-zahlen-deutsche-in-ihrem-leben
Die spannendsten Ergebnisse gleich vorweg:
• Die Steuern und Abgaben betragen im Durchschnitt 814.212 Euro pro Kopf – exklusive Lohnnebenkosten, die der Arbeitgeber darüber hinaus abführt.
• Mit 36% machen den Löwenanteil davon 293.247 Euro Einkommensteuer und Solidaritätszuschlag aus, gefolgt von 154.416 Euro Mehrwertsteuer und durchschnittlich 139.390 Euro für die Krankenversicherung.
• Zur Einordnung: Das durchschnittliche Lebenseinkommen von Frauen und Männern liegt in Deutschland bei 1.888.076 Euro, damit liegt die durchschnittliche Steuer- und Abgabenlast bei 43,1%.
• Im Schnitt werden die Deutschen erst mit 24 Jahren zu Netto-Einzahlern, ab 65 Jahren dreht sich das Verhältnis aus Einzahlungen und bezogenen Leistungen wieder.
Die Lebensleistung der Deutschen in Zahlen
Im Vergleich zu anderen OECD-Ländern belegt Deutschland im Ranking zur Steuer- und Abgabenlast regelmäßig Spitzenpositionen. Einzige Ausnahme bilden dabei hohe Vermögen und Erbschaften, die in Deutschland zum großen Teil am Fiskus vorbeigehen. Während hierzulande ein Single mit Durchschnittsverdienst laut OECD-Studie im vergangenen Jahr 51,9 Prozent seines Gehalts an den Fiskus abführen musste, lag der OECD-Schnitt bei 44,6 Prozent. Nach Berechnungen des Bund der Steuerzahler e.V. gehen für einen durchschnittlichen Arbeitnehmerhaushalt sogar 53 Prozent vom Einkommen ab. Die Zahlen legen nahe, dass den Deutschen von einem Euro lediglich 47 Cent übrigbleiben und wir erst in der zweiten Jahreshälfte beginnen, für das eigene Konto zu arbeiten. Doch das Geld für Steuern und Abgaben ist nicht einfach weg.
Für die Analyse hat WeltSparen sämtliche Steuern und Abgaben den Transfer- und Sachleistungen auf Personenebene gegenübergestellt, die für den aktuellen IW-Report 7/2022 je Lebensjahr simuliert wurden. Das Referenzjahr für die Analyse ist 2021.
Unter dem Strich bleibt ein Plus
Betrachtet man den Status Quo der Umverteilung durch Steuern und Abgaben, bleibt auf Personenebene über die gesamte Lebenszeit im Schnitt sogar ein Plus an Transfers und staatlichen Sachleistungen von 53.738 Euro. Maßgeblicher Treiber für diese positive Differenz auf Personenebene ist das umlagefinanzierte Rentensystem, das seit 2020 jährlich mit über 100 Milliarden Euro zusätzlich aus Steuermitteln finanziert werden muss – Tendenz steigend.
Jede:r vierte Deutsche handhabt Finanzablage chaotisch
In diesem Jahr haben Steuerzahler:innen etwas mehr Zeit für ihre Steuererklärung - trotzdem lohnt es sich, die eigenen Finanzen nicht erst auf den letzten Drücker zu organisieren. Für die Mehrheit der Deutschen ist das auch kein Problem, doch bei knapp jedem:r vierten Bundesbürger:in sind die Finanzen noch chaotisch oder ungeordnet (24 Prozent). Das zeigt eine aktuelle bevölkerungsrepräsentative Studie des digitalen Versicherungsmanagers CLARK in Zusammenarbeit mit YouGov. Demnach sind 72 Prozent der Bundesbürger:innen hinsichtlich ihrer Finanzen organisiert, über die Hälfte setzt dabei noch auf physische Ordner, in dem alle Unterlagen gesammelt werden (52 Prozent). Knapp jede:r fünfte Befragte ist digital organisiert und sortiert die Unterlagen auf dem Computer (19 Prozent). Immerhin eine von zehn Personen greift auf die Hilfe von Steuer- oder Finanzberater:innen zurück (11 Prozent). Aber nicht alle Menschen in Deutschland haben ihre Finanzen so vorbildlich im Griff: Bei 9 Prozent gibt es Schubladen oder Kartons, in denen alle Unterlagen unsortiert reingelegt werden. Und ganze 15 Prozent der Deutschen organisieren ihre Finanzen überhaupt nicht.
Sparen bei Versicherungen und Altersvorsorge
Wenn die Finanzen für die Steuererklärung sortiert werden, ist es sinnvoll, sich ebenfalls die eigene Versicherungssituation und die persönliche Altersvorsorge noch einmal genauer anzuschauen. Denn auch hier gibt es häufig Sparpotential. Zum einen können durch einen Versicherungsvergleich und eine unabhängige Beratung die laufenden Kosten in den meisten Fällen gesenkt werden, zum anderen können bestimmte Versicherungen in der Steuererklärung angegeben werden.
Angestellte haben so zum Beispiel die Möglichkeit, die Kfz-Haftpflichtversicherung steuerlich geltend zu machen. Selbstständige können zusätzlich sogar die Kaskoversicherung absetzen. "Welche Kosten im Einzelfall geltend gemacht werden können, hängt von der Berufsgruppe, der Fahrzeugnutzung und vom Einkommen des Fahrzeughalters ab. Letztendlich richtet es sich nach dem individuellen Steuersatz, wie hoch der eingesparte Betrag durch das Absetzen der Autoversicherung in der Steuererklärung für die oder den Einzelnen ausfällt," weiß Dr. Marco Adelt, COO und Co-Gründer von CLARK.
Außerdem kann auch im Rahmen einer Versicherung für die Altersvorsorge kräftig gespart werden. Auch hier gibt es keine pauschalen Tarife und die Kosten sind ebenfalls abhängig vom jeweiligen Versicherungstyp. So unterscheidet sich beispielsweise die steuerliche Behandlung einer Rürup- oder Riester-Versicherung von einer privaten Rentenversicherung. Während 92 Prozent der Höchstbeiträge der Rürup-Versicherung absetzungsfähig sind, können die Beiträge für die private Rentenversicherung nicht von der Steuer abgesetzt werden - es sei denn, der Vertrag wurde vor 2005 abgeschlossen. "Eine individuelle Beratung ist daher essentiell, damit jede:r die Möglichkeit bekommt, mit einer ausführlichen Steuererklärung effektiv zu sparen", erklärt Adelt.
Steuererklärung 2022: vom Homeoffice profitieren
Neben den Versicherungen gibt es auch noch einen weiteren Kostenpunkt, der in der Steuererklärung geltend gemacht werden kann: das Homeoffice. Auch wenn die Homeoffice-Pflicht zum 19. März 2022 ausgelaufen ist, kann man für das Jahr 2021 noch gut von der Regelung profitieren. Denn für alle, die ihren Arbeitsplatz auch zu Hause aufgebaut haben, ist es wichtig zu wissen, dass unter bestimmten Voraussetzungen die Kosten für ein Arbeitszimmer als Werbungskosten oder Betriebsausgaben in der Steuererklärung angegeben werden können. Absetzbar sind unter anderem auch Teile der Miet-, Wasser- und Energiekosten. Dafür muss mindestens an drei von fünf Tagen in der Woche zu Hause gearbeitet werden.
Aber auch diejenigen, die kein steuerlich anerkanntes Arbeitszimmer besitzen, können bestimmte Job-Kosten beim Finanzamt geltend machen. So zählen unter anderem Arbeitsmittel wie ein neuer Laptop, Schreibtisch oder Bürostühle zu den sogenannten Werbungskosten und können ebenfalls von der Steuer abgesetzt werden.
[1] Die verwendeten Daten beruhen auf einer Online-Umfrage der YouGov Deutschland GmbH, an der 1002 Personen zwischen dem 14.03. und 16.03.2022 teilnahmen. Die Ergebnisse wurden gewichtet und sind repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren.
Steuerbefreiung für eigenen Ökostrom möglich
Photovoltaikanlagen auf Wohnhäusern gehören mittlerweile vielfach zum Stadtbild, liefert eine solche Anlage doch günstigen Solarstrom frei Haus. Wird aus der Anlage allerdings auch Strom ins öffentliche Stromnetz eingespeist, dann gilt der Betrieb der Photovoltaikanlage als Gewerbebetrieb, dessen Einnahmen dem Finanzamt offengelegt werden müssen. Die Wüstenrot Bausparkasse AG berichtet, dass kleinere Stromproduzenten sich jetzt von der Pflicht zur Versteuerung befreien lassen können.
Nachhaltige Stromerzeugung mittels Photovoltaik liegt im Trend – viele Menschen haben sich daher für eine Photovoltaikanlage auf ihrem Eigenheim entschieden. Die Anlage liefert vielfach aber nicht nur Ökostrom für den Eigenbedarf, sondern speist eventuell auch einen Teil des erzeugten Stroms ins öffentliche Stromnetz ein. Dafür erhaltenes Entgelt gilt steuerlich als Einnahme aus einem Gewerbebetrieb – das Finanzamt will dann für jedes Jahr des Betriebs im Rahmen der Einkommensteuererklärung grundsätzlich eine sogenannte Einnahmenüberschussrechnung (EÜR) von der Eigentümerin oder dem Eigentümer der Photovoltaikanlage sehen.
Bis vor Kurzem galt diese Vorgabe für alle Photovoltaikanlagen, unabhängig von der erzeugten Strommenge. Für Anlagen mit bis zu 10 Kilowatt installierter Gesamtleistung, die seit 2004 auf selbstgenutzten Ein- und Zweifamilienhäusern oder für eigene Wohnungen auf Mehrfamilienhäusern errichtet wurden, hat das Bundesfinanzministerium im letzten Sommer jedoch Erleichterungen beschlossen. Sind mehrere Anlagen eines Eigentümers oder einer Eigentümerin installiert, werden die Leistungen der Einzelgeräte addiert, wobei auch dann die installierte Gesamtleistung dieser Anlagen zehn Kilowatt nicht überschreiten darf.
In einem schriftlichen Antrag können Eigenheimbesitzerinnen und -besitzer jetzt gegenüber dem Finanzamt erklären, dass ihre Stromerzeugungsanlage oder ihre Anlagen ohne Gewinnerzielungsabsicht betrieben werden. Damit entfällt die Pflicht zur Erklärung dieser Einkünfte für die Einkommensbesteuerung. Die Erklärung gilt rückwirkend für noch unversteuerte Vorjahre sowie für die zukünftige steuerliche Veranlagung. Auch für Blockheizkraftwerke mit einer Leistung bis zu 2,5 Kilowatt, die seit 2004 für die Versorgung von Ein- oder Zweifamilienhäusern installiert wurden, akzeptiert der Fiskus diese Option.
Wüstenrot betont, dass sich gerade in den ersten Jahren nach der Installation eine Versteuerung erzielter Erträge aus der eigenen Stromproduktion steuermindernd auswirken kann. Besitzerinnen und Besitzer kleinerer Photovoltaikanlagen oder Blockheizkraftwerke sollten das Thema daher mit Steuerfachleuten besprechen, bevor sie sich von der Steuerpflicht für ihre Anlage befreien lassen.
Privatverkauf eines Tiny House ist steuerfrei
Wohnen auf wenigen Quadratmetern
Tiny Houses, englisch für „winzige Häuschen“, sind auch in Deutschland auf dem Vormarsch. Der Wohntrend aus den USA, Kanada und Australien ist herübergeschwappt. Mit einer durchschnittlichen Quadratmeterzahl von 29 qm entsprechen sie der Wohnfläche eines 1-Zimmer-Appartements und beeinhalten neben Küche und Bad einen Wohn- und Schlafbereich. Der Durchschnittspreis von 67.000 Euro liegt jedoch weit unter den Anschaffungskosten einer Wohnung in einem Ballungsraum. Bei Bedarf können sie auf ein Fahrgestell montiert, weggefahren und woanders wieder aufgestellt werden.
Was sind die Motive von Tiny-House-Besitzern?
Ein Tiny House ist immerhin etwas Eigenes im Gegensatz zu einer Mietwohnung. Und im Vergleich zu einem Campingwagen bietet das mobile kleine Eigenheim ein gehobeneres Wohnniveau. Obwohl in Deutschland fast immer eine Baugenehmigung für ein Mobilhaus erforderlich ist, handelt es sich nicht um eine Immobilie, sondern um eine Art Wohnmobil. Laut einer deutschen Tiny-House-Studie ist für 83 Prozent eine minimalistische Lebenshaltung ausschlaggebend. An zweiter Stelle steht der Wunsch nach einem bezahlbaren Eigenheim in Zeiten horrender Immobilienpreise. Mobilität steht zwar nicht im Vordergrund, ist aber für 38 Prozent dennoch ein Kaufargument. 42 Prozent nutzen es als Wochenend- oder Ferienhaus, teilweise auf Grundstücken, auf denen keine feste Bebauung erlaubt ist. Auch für Rentner mit einer geringen Rente ist das Tiny House attraktiv. Wer in der glücklichen Lage ist, sein Häuschen auf dem Privatgrundstück der Kinder oder Verwandten abstellen zu dürfen, kann so mietfrei leben.
Was ist bei einem Verkauf steuerlich zu beachten?
Jüngst ging ein Steitfall vor Gericht. Der Kläger hatte von einer Campingplatzbetreiberin ein relativ großes, aber dennoch mobiles Holzhaus mit rund 60 Quadratmetern gekauft. Dieses stand auf einer von ihm gemieteten Parzelle des Campingplatzes. Vier Jahre später veräußerte er das Mobilheim und erzielt dabei einen Gewinn. Das Finanzamt nahm sogleich ein steuerpflichtiges Spekulationsgeschäft an, bei dem die zehnjährige Haltefrist für Grundstücke nicht erfüllt war, und besteuerte den Gewinn. Der Verkäufer setzte sich zur Wehr, da das Mobilhaus nicht fest mit dem Boden verbunden war und das Grundstück selbst nicht verkauft wurde. Da es sich damit um keine echte Immobilie handelte, konnte seiner Meinung nach der private Verkauf auch nicht einkommensteuerpflichtig sein.
Der Kläger hatte mit seiner Argumentation vor dem Finanzgericht Erfolg. Die Zehnjahresfrist gelte nur für Grundstücksverkäufe. Wird ein nicht mit dem Boden verbundenes Haus verkauft, fällt es nach Auffassung des Gerichts nicht unter diese gesetzliche Regelung, sofern das Grundstück nicht den Eigentümer wechselt. Das gelte auch dann, so das Finanzgericht, wenn beim Kauf des mobilen Häuschens Grunderwerbsteuer zu zahlen war. „Dasselbe muss folglich auch für den Verkauf von Tiny Houses gelten“, informiert Tobias Gerauer, Vorstand der Lohi. Da das Finanzamt Revision gegen das Urteil einlegte, ist der Fall noch nicht abgeschlossen. „Das letzte Wort hat also wieder der Bundesfinanzhof“, so Gerauer.
Gesetzesentwurf zur Neuregelung der Steuerzinsen: 1,8 Prozent p.a.
Die neue Bundesregierung hat auf die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) vom Sommer 2021 reagiert. Sie hat einen Entwurf für die geforderte Neuregelung des Zinssatzes in der Abgabenordnung für Steuernachforderungen und -erstattungen vorgelegt. Das Urteil des höchsten Gerichts hatte im vergangenen Jahr für großes Aufsehen gesorgt. Um die Praxistauglichkeit zu gewährleisten, wird künftig abermals ein starrer Zinssatz im Steuerwesen eingesetzt. Jedoch soll eine regelmäßige Evaluierung hinzukommen, um mehr Realitätsnähe zu erreichen. Ein flexibler Zinssatz kam im Hinblick auf eine schwierigere Handhabung und damit verbundene Planungsunsicherheiten für das BMF nicht in Betracht, so die Lohnsteuerhilfe Bayern.
Die Lohi erläutert, was die Regierungspläne beinhalten.
Das BVerfG hatte in einem Urteil den Steuerzinssatz von 6 Prozent p.a. aufgrund der vorherrschenden Niedrigzinsphase am Kapitalmarkt für Verzinsungszeiträume ab dem Jahr 2014 für überhöht und verfassungswidrig erklärt. Eine Zinskorrektur wurde jedoch erst für die Verzinsungszeiträume, die in das Jahr 2019 oder später fallen, angeordnet. Bis spätestens Ende Juli muss der Gesetzgeber eine verfassungskonforme Neuregelung dazu erlassen haben. Nun legte das Bundesfinanzministerium einen Referentenentwurf für das Zweite Gesetz zur Änderung der Abgabenordnung und des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung (2. AOÄndG) vor. Am 30.03.2022 hat das Bundeskabinett die Neuregelung beschlossen. Nun muss sie noch vom Bundestag verabschiedet werden und der Bundesrat muss zustimmen.
Etwas mehr Realitätsnähe beim Zinssatz vorgesehen
Mit dem Entwurf des 2. AOÄndG soll der bisherige Zinssatz für Nachzahlungs- und Erstattungszinsen von 0,5 Prozent pro Monat auf 0,15 Prozent pro Monat, und damit auf 1,8 Prozent pro Jahr, gesenkt werden. Wie kamen die 1,8 Prozent zustande? Die 1,8 Prozentpunkte orientieren sich am aktuellen Basiszinssatz nach dem BGB von -0,88 Prozent mit einem Aufschlag von 2,7 Prozentpunkten, was laut Referentenentwurf einen sachgerechten Zuschlag darstellen soll. Der Zinssatz bleibe damit deutlich unterhalb des Zinssatzes für Verzugszinsen nach dem BGB und sei ein angemessener Mittelwert zwischen Guthaben- und Verzugszinsen.
Diese Detailregelung soll neu dazu kommen
Des Weiteren soll mit Teilverzinsungszeiträumen in Fällen gerechnet werden, in denen unterschiedliche Zinssätze im Zinslauf zur Anwendung kommen. Dies ist z.B. der Fall, wenn sich der Verzinsungszeitraum vom 1. Mai 2018 bis zum 15. Juli 2019 erstreckt. Für Teilverzinsungszeiträume ist jeweils tageweise zu rechnen, wobei ein Kalendermonat grundsätzlich mit 30 Zinstagen angesetzt wird. Die Anzahl der tatsächlichen Kalendertage je Kalendermonat spielt keine Rolle. Um den Anteil am Jahreszinssatz zu ermitteln, wird die Summe der ermittelten Zinstage durch 360 geteilt.
Regelmäßige Überprüfung der Angemessenheit geplant
Damit der Verwaltungszinssatz künftig nicht wieder so krass von der Realität am Markt abweicht, sieht das Gesetz vor, dass der Basiszinssatz regelmäßig alle drei Jahre überprüft werden soll. Sollte der Basiszinssatz künftig um mehr als einen Prozentpunkt gegenüber dem zuletzt geltenden Zinssatz abweichen, soll eine Anpassung des Zinssatzes erfolgen. Diese soll dann für künftige Verzinsungszeiträume gelten. Die erste Evaluation wurde für den 1. Januar 2026 festgesetzt.
Verbraucher dürfen sich über Vertrauensschutz freuen
Im Hinblick auf die laufenden Verfahren wurden Zinsfestsetzungen für Zeiträume ab Mai 2019 vom Finanzamt mit einem Vorläufigkeitsvermerk versehen. Auch sind noch viele Steuerbescheide aus den vergangenen Jahren offen, weil die Steuerzahler Einspruch gegen den hohen Zinssatz erhoben haben. Bei diesen noch nicht bestandskräftig festgesetzten Zinsen werden die Finanzämter nach Abschluss des Gesetzgebungsverfahrens den neuen Zinssatz rückwirkend ab Januar 2019 anwenden. Im Fall der Neuberechnung von Erstattungszinsen durch Aufhebung oder Änderung des Steuerbescheids darf der Steuerpflichtige aber im Vergleich zur letzten Zinsfestsetzung nicht schlechter gestellt werden. Das bedeutet, dass weder eine Rückzahlung festgesetzter noch vorläufig erhaltener Erstattungszinsen erforderlich ist.
Keine Anpassung weiterer Zinsen im Gesetzentwurf enthalten
Der neue gesetzliche Zinssatz betrifft Stundungs-, Hinterziehungs- und Aussetzungszinsen zulasten der Steuerpflichtigen nicht. Hier wird weiterhin ein Zinssatz von 6 Prozent p.a. angewendet, da sich die Entscheidung des Gerichts hier ausdrücklich nicht auf andere Regelungen zur Verzinsung erstreckt hat. Diese Sachverhalte werden laut Gesetzgeber noch geprüft. Ob und wann hier eine Anpassung erfolgt, bleibt offen. Wenn für andere Zinsen aber ein anderer Grundsatz gilt, führt das in der Praxis zu Ungerechtigkeiten.
„Es gilt das Gebot der gleichmäßigen Besteuerung. Dem sollte durch einheitliche Zinssätze Rechnung getragen werden“, so Tobias Gerauer, Vorstand der Lohi. Bleibt es bei den unterschiedlichen Sätzen, werden z.B. Steuerzahler, die ihre Steuererklärung abgegeben haben und deren Steuernachzahlung gestundet oder wegen eines Rechtsstreits ausgesetzt wurde, mit der neuen Lösung schlechter gestellt als diejenigen, bei denen die Finanzverwaltung Steuernachforderungen erst im Nachhinein festgestellt hat.
Steuerentlastungsgesetz 2022: Wieviel sich sparen lässt
Das Bundeskabinett hat am 16. März 2022 den Entwurf des Steuerentlastungsgesetzes 2022 beschlossen. Der Koalitionsausschuss hat sich am 23. Februar 2022 auf drei Maßnahmen geeinigt: höhere Entfernungspauschale, höherer Arbeitnehmer-Pauschbetrag und höherer Grundfreibetrag. „Das soll die hohen Energiekosten abfedern“, sagt Ecovis-Steuerberater Stefan Lange in Erfurt und rechnet vor, wie viel Ersparnis drin sein können.
Folgende steuerliche Entlastungsmaßnahmen sieht der Gesetzentwurf vor. Sie gelten dann rückwirkend zum 1. Januar 2022. Von den Entlastungen profitieren Arbeitnehmer wie angestellte GmbH-Geschäftsführer:
1 Anhebung der erweiterten Entfernungspauschale auf 38 Cent für Fernpendler
Vor allem Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit einer überdurchschnittlich langen Pendelstrecke zum Arbeitsplatz spüren die aktuell hohen Benzinkosten im Geldbeutel. Um dies bei der Steuererklärung etwas abzumildern, will die Ampelkoalition die erweiterte Pendlerpauschale ab dem 21ten Kilometer um drei Cent anheben.
2 Erhöhung des Arbeitnehmer-Pauschbetrags auf 1.200 Euro
Der pauschale Abzugsbetrag für Werbungskosten, der sich ohne weitere Belege bei der Einkommensteuererklärung berücksichtigen lässt, steigt rückwirkend zum 1. Januar 2022 um 200 Euro. Dadurch können auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer profitieren, die bisher – zum Beispiel aufgrund eines kürzeren Arbeitswegs – weniger Werbungskosten abziehen konnten.
3 Anhebung des Grundfreibetrags für 2022 auf 10.347 Euro
Mit der Anhebung des Grundfreibetrags, der bisher bei 9.744 Euro liegt, sinkt der individuelle Steuersatz vor allem für kleine Gehälter spürbar. Denn erst der 10.348ste Euro unterliegt jetzt der Besteuerung. „Dies soll vor allem die gestiegenen Kosten für die Lebenshaltung ausgleichen“, sagt Ecovis-Steuerberater Stefan Lange in Erfurt.
Was der höhere Arbeitnehmer-Pauschbetrag und der höhere Grundfreibetrag bringen – zwei Beispiele:
zu versteuerndes Einkommen Steuerersparnis gegenüber 2021
1. Single-Haushalt 35.000 € 212 €
2. Familie 50.000 € 378 €
Ein Single-Haushalt mit 35.000 Euro zu versteuerndem Einkommen profitiert im Vergleich zu 2021 von einer Steuerersparnis von 212 Euro.
Eine Familie mit 50.000 Euro zu versteuerndem Einkommen profitiert im Vergleich zu 2021 von 378 Euro Steuerersparnis, wenn die Steuererklärung für das Jahr 2022 vom Finanzamt veranlagt wird.
Wann das Gesetz durch das Parlament und den Bundesrat beschlossen wird, steht noch nicht fest. „Wir gehen davon aus, dass das Gesetz noch im ersten Halbjahr rechtskräftig wird“, sagt Stefan Lange.
Nachzahlungszinsen:nur noch 1,8 Prozent, statt 6 Prozent
Die Finanzämter dürfen ab 2019 nicht mehr so hohe Nachzahlungszinsen berechnen. Statt sechs Prozent dürfen sie künftig nur noch 1,8 Prozent verlangen. Das steht in einem aktuellen Gesetzesentwurf aus dem Bundesfinanzministerium. Das Bundesverfassungsgericht hatte die bislang geltenden sechs Prozent Steuerzinsen pro Jahr als verfassungswidrig erklärt. Die Details kennt Ecovis-Steuerberater Alexander Kimmerle in Kempten.
Das Verfassungsgericht beanstandete die bisherigen Nachzahlungszinsen von 0,5 Prozent pro Monat, also 6 Prozent pro Jahr. Wie hoch sollen die neuen Zinssätze sein?
Der Zinssatz, der rückwirkend ab 1. Januar 2019 von den Finanzämtern anzuwenden ist, soll sich monatlich auf 0,15 Prozent belaufen und somit 1,8 Prozent pro Jahr betragen.
Ab wann und für welche Steuerjahre gilt der neue Zinssatz?
Seit 2014 sind die Zinsen grundsätzlich verfassungswidrig, da sie realitätsfern sind. Das Verfassungsgericht gestattete dem Gesetzgeber jedoch, dass er erst ab 2019 die Verzinsung neu regeln muss. Von dieser Möglichkeit hat der Gesetzgeber Gebrauch gemacht. Die neuen Zinssätze gelten damit erst ab dem Jahr 2019. Für alle Zinsmonate bis einschließlich Dezember 2018 wird es also bei 0,5 Prozent pro Monat bleiben, danach müssen Steuerzahler nur noch einen Monatszinssatz von 0,15 Prozent bezahlen.
Gelten die künftigen niedrigeren Zinsen auch für Steuerhinterziehungszinsen, Aussetzungszinsen und Stundungszinsen?
Leider nein, diese bleiben bei 6 Prozent pro Jahr. Das Bundesverfassungsgericht hat diese Verzinsung nicht beanstandet. Grund hierfür ist, dass diese Art von Zinsen durch den Steuerzahler vermeidbar wären oder er sich um eine günstige Alternativfinanzierung, beispielsweise ein Bankdarlehen, kümmern kann.
Bisher wurden bei neuen Steuerbescheiden keine Zinsen mehr festgesetzt. Drohen jetzt Nachforderungen oder kann man sich auf Erstattungen freuen?
Für alle Steuerbescheide, bei denen keine Zinsen mehr festgesetzt wurden, holen die Finanzämter das nach. Allerdings handelt es sich derzeit nur um einen Referentenentwurf. Es wird also noch etwas dauern, bis das Gesetz endgültig verabschiedet ist und zur Anwendung kommt.
Was passiert mit den Erstattungszinsen, die bei alten Steuerbescheiden schon für 2019 ausbezahlt wurden, da sie noch vor dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts ergangen sind? Kommt es zur Rückforderung durch das Finanzamt?
In der Regel nein, denn es soll Vertrauensschutz gelten. Das Finanzamt wird die Erstattungszinsen also grundsätzlich nicht zurückfordern. Wird der Bescheid allerdings aus einem anderen Grund geändert, soll die Verrechnung von bisher festgesetzten Erstattungs- und Nachzahlungszinsen zum alten Zinssatz erfolgen. Erst bei Verrechnung über null, wird dann der neue Zinssatz angewandt. Betroffene sollten die Berechnung in jedem Fall überprüfen.
Muss die Steuererklärung elektronisch eingereicht werden?
Arbeitnehmer und Rentner dürfen trotz Nebeneinkünften in Papierform abgeben
Steuerpflichtige müssen ihre Steuererklärung an die Finanzbehörden seit 2011 elektronisch übermitteln, wenn sie selbstständig tätig sind, ein Gewerbe betreiben oder Einnahmen aus der Land- oder Forstwirtschaft erzielen. Erledigen sie das mit den Papiervordrucken, gilt die Steuererklärung als nicht eingegangen. Arbeitnehmer und Rentner hingegen dürfen ihre Steuererklärung weiterhin jedes Jahr in Papierform beim Finanzamt einreichen. Zum Streitfall kommt es immer wieder, wenn ein Angestellter aus einer Nebentätigkeit weitere Einkünfte erzielt, bei denen die digitale Steuererklärung gesetzlich vorgeschrieben ist, so die Lohnsteuerhilfe Bayern.
Nebeneinkünfte verlangen keine Änderung der Form
In einem solchen Verfahren fällte der Bundesfinanzhof (BFH) kürzlich ein wegweisendes Urteil für alle Arbeitnehmer mit Nebeneinkünften. Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung oder Kapitalerträgen spielen bei der Form der Abgabe keine Rolle. Ansonsten ist der Haupterwerb ausschlaggebend und nicht die Einnahmen nebenbei, welche meist vergleichsweise geringfügig ausfallen. Denn einem hauptberuflich Angestellten steht die Abgabe in Papierform mit den amtlichen Formularen nach dem Einkommenssteuergesetz zu, wenn er verpflichtet ist, eine Erklärung abzugeben. Das kann zum Beispiel durch den Bezug von Kurzarbeitergeld ausgelöst werden. Fordert das Finanzamt in einem solchen Fall zur digitalen Abgabe auf, könne man mit Berufung auf das Urteil mit dem Aktenzeichen X R 36/19 die Akzeptanz der Abgabe in Papierform erwirken.
Entscheidung zugunsten von Photovoltaik-Betreibern
Im konkreten Fall widersetzte sich ein Ehepaar dem Finanzamt und dem verhängten Zwangsgeld, da beide Ehegatten ihre Einkünfte für den Lebensunterhalt aus ihren jeweiligen Angestelltenverhältnissen erwerben. Sie waren in den Steuerklassen III und V eingruppiert. Zum Problemfall war die auf dem Hausdach angebrachte Photovoltaikanlage geworden. Denn Betreiber von Photovoltaikanlagen wurden bislang der gewerblichen Tätigkeit zugeordnet. Somit ist die Entscheidung des obersten Gerichts für alle Eigenheimbesitzer mit einer privaten Photovoltaikanlage von Interesse. Die Steuerklassenwahl der Kläger verpflichtete sie unabhängig von der PV-Anlage schon eine Erklärung abzugeben. Sie müssen daher nicht zwangsläufig die Steuerunterlagen in digitaler Form abgeben.
In ähnlich gelagerten Fällen argumentierte der BFH zuvor, dass die Anschaffungskosten für die notwendige Technik zur digitalen Abgabe bei geringfügigen Einnahmen aus einem Kleinstgewerbe in einem sinnvollen Verhältnis stehen müssten. Die Ausgaben für eine digitale Erstellung und Übermittlung müssen wirtschaftlich und persönlich zumutbar sein. Dies trifft bei Nebenerwerbslandwirten, Selbstständigen und Gewerbetreibenden, deren Business nur geringe Einkünfte einbringt und die technischen Voraussetzungen für die elektronische Steuererklärung erst noch geschaffen werden müssen, aber manchmal nicht zu. Daher können die Steuerpflichtigen der elektronischen Abgabe auf Antrag mit Verweis auf das Aktenzeichen VIII R 29/17und VIII R 29/19 ebenfalls entgehen, so die Lohnsteuerhilfe Bayern.
Anteilige Kosten für Straßenbau steuerlich absetzbar?
Wenn die Bagger vor dem Haus anrollen, wird es für Wohneigentümer richtig teuer
Werden Bauarbeiten am eigenen Grundstück, wie die Pflasterung der eigenen Hofeinfahrt, von einem Unternehmen durchgeführt, kann ein Teil der Lohnkosten von der Einkommensteuer in Abzug gebracht werden. Wird eine neue Straße gebaut, werden die Kosten auf die angrenzenden Grundstückseigentümer anteilig umgelegt und diese von der Gemeinde in Form von Erschließungs- oder Verbesserungsbeiträgen zur Kasse gebeten. Meist handelt es sich dabei um nicht geringe Beträge, die für die Eigentümer ein Finanzierungsproblem darstellen.
Steuerzahler versuchen daher immer wieder, diese Kosten in ihrer Steuererklärung als Handwerkerleistungen geltend zu machen. Diese Vorgehensweise wurde zuletzt 2020 vom obersten Finanzgericht beurteilt. Die Lohi erklärt, in welchen Fällen ein Steuerabzug erfolgreich und in welchen er ausgeschlossen ist.
Arbeiten auf dem Grundstück
Ein Haushalt wird durch die Grundstücksgrenzen definiert. Die Eigentumsverhältnisse sind dabei egal. So gehört ein gemeinschaftlich genutzter Garten eines Mehrparteienhauses steuerrechtlich zum Haushalt der Anwohner. Für Handwerkerleistungen, die in einem privaten Haushalt erbracht werden, gibt es grundsätzlich einen Steuerbonus von 20 Prozent auf die Lohnkosten für Kosten bis zu 6.000 Euro pro Jahr. Die maximale Steuerermäßigung beträgt also 1.200 Euro. Dieser Steuervorteil kann z.B. genutzt werden, wenn eine Gartenmauer errichtet wird, die das Grundstück einzäunt.
Dienstleistungen am Bürgersteig
Es sind jedoch nicht nur Dienstleistungen auf dem eigenen Grundstück, sondern auch auf dem angrenzenden öffentlichen Grund steuerbegünstigt. Zum Beispiel, wenn ein Hausmeisterservice den öffentlichen Gehweg, der an ein Privathaus angrenzt, von Schnee befreit und streut. Diese Lohnkosten können als haushaltsnahe Dienstleistungen ebenfalls mit 20 Prozent steuerlich geltend gemacht werden, da sie in einem räumlichen und funktionalen Zusammenhang mit dem Haushalt stehen. Hier beträgt die maximale Steuerermäßigung 4.000 Euro.
Straßenbau für die Allgemeinheit
Im Fall der Kosten einer Straßenerschließung entschied der Bundesfinanzhof, dass diese Kosten nicht steuerlich abzugsfähig sind. Begründet wurde das damit, dass der allgemeine Straßenbau nicht in einem räumlich-funktionalen Zusammenhang mit dem angrenzenden Privathaushalt steht, obwohl er den einzelnen Anwohnern einen Vorteil bietet. Dies spielt aber eine untergeordnete Rolle. Generell betrachtet kommt eine öffentliche Straße nämlich nicht nur einem Grundstückseigentümer, sondern allen Nutzern dieser Straße zugute. Ist der Nutzen nicht auf den Anwohner beschränkt, muss dieser die Kosten der Straßenerschließung tragen. Dementsprechend bezahlen Anwohner mit einem Erschließungsbeitrag nicht nur den vor ihrem Grundstück befindlichen Teil der Straße, sondern einen Teil der gesamten Baukosten, unabhängig davon, ob sich die Straße vor ihrem Grundstück oder zehn Häuser weiter befindet. Eine steuerliche Förderung für die Allgemeinheit ist in der privaten Einkommenssteuererklärung ausgeschlossen.
Grundstücksanschluss des Haushalts
Anders verhält es sich, wenn es sich um eine Grundstückszufahrt handelt, die von einer öffentlichen Straße zu einem Privathaushalt abzweigt. Diese Kosten sind steuerlich begünstigt, da dieser spezielle Straßenabschnitt dem Anwohner dient und nicht öffentlich befahren wird. Diese Trennung zwischen dem öffentlichen Netz, bei dem ein Steuerabzug ausgeschlossen ist, und einem Haus- oder Grundstücksanschluss an das öffentliche Netz, das einen Steuerabzug vorsieht, gilt auch für alle anderen Gas- Wasser und Stromanschlüsse. Wichtig: Die Kosten müssen dem Haushalt direkt zuordenbar sein. Für eine steuerliche Förderung müssen die Hausanschluss- oder Hausverbindungskosten durch die Gemeinde gesondert abgerechnet werden und dürfen nicht im Erschließungs- oder Verbesserungsbeitrag aufgehen.
Steuererleichterungen bei Hochwasserschäden
Die schweren Unwetter im Juli 2021 haben beträchtliche wirtschaftliche Schäden bei Privatpersonen und Firmen hinterlassen. Angefangen bei den Gebäuden, die durch Wasser und Schlamm enorme Schäden erlitten haben, über Autos und alle anderen beweglichen Güter, die von der Flut einfach weggeschwemmt wurden, bis zu Unterlagen und Dokumenten, die durch das Hochwasser entweder verloren gingen oder unbrauchbar wurden. Die Finanzverwaltungen der betroffenen Bundesländer haben daher Katastrophenerlässe herausgegeben, die verschiedene Steuererleichterungen vorsehen. Aber es gibt auch reguläre Steuervorteile, die Hochwasseropfer unbedingt beanspruchen sollten, so die Lohnsteuerhilfe Bayern.
Hochwasserschäden als außergewöhnliche Belastungen
Um die Hochwasserschäden zu beseitigen, die Wohnung zu räumen und instand zu setzen, müssen die Flutopfer tief in die Tasche greifen. Da kommen schnell hohe Summen zusammen. Gut, dass zumindest ein Teil davon über die außergewöhnlichen Belastungen in der Steuererklärung zurückgeholt werden kann. Leider wird aber grundsätzlich ein zumutbarer Eigenanteil berücksichtigt, der nach der Einkommenshöhe, dem Familienstand und der Kinderzahl berechnet wird. Dieser Sockelbetrag wird vom Finanzamt berechnet und in Abzug gestellt, d.h. er muss selbst getragen werden. Die Aufwendungen darüber hinaus können steuerlich abgesetzt werden.
Es werden jedoch nur existentiell notwendige Ausgaben akzeptiert. Darunter fallen die Räumungs- und Entsorgungskosten, Arbeiten am eigenen Wohngebäude mit Ausnahme des Kellers, der Austausch der Heizungsanlage sowie die Wiederbeschaffung der Möbel, des Hausrats und der Bekleidung. Die Ausgaben für den PKW, die Garage und Terrasse werden nicht als lebensnotwendig erachtet und daher nicht anerkannt. Auch Besitzer einer Ferienwohnung gehen leer aus, sofern diese nicht zur Vermietung unterhalten wird. Zudem müssen sich die Kosten in einem angemessenen Rahmen bewegen. Ein Steuerbonus für den Ersatz von Schmuck, Kunstgegenständen und anderen Luxusgütern ist ausgeschlossen.
Die Wiederbeschaffungsmaßnahmen müssen innerhalb von drei Jahren abgeschlossen sein, die Reparaturarbeiten wenigstens in diesem Zeitraum begonnen haben, damit sie das Finanzamt im Zusammenhang mit der Katastrophe anerkennt. Ist eine Finanzierung nur über einen längeren Zeitraum zu stemmen, muss das nachvollziehbar dargelegt werden.
Handwerkerleistungen mindern die Steuerlast
Wenn die Kosten nicht als außergewöhnliche Belastungen beantragt werden oder dies nicht möglich ist, können professionell ausgeführte Handwerksarbeiten als Handwerkerleistung abgesetzt werden. Allerdings sind diese auf die Arbeitsstunden, Anfahrt und Maschinenmiete beschränkt. Materialkosten sind nicht absetzbar. Und nur 20 Prozent der Bruttoarbeitskosten dürfen in der Steuererklärung angesetzt werden. Dafür werden diese direkt von der Einkommensteuer abgezogen. Die Steuerlast kann mit Handwerkerkosten bis zu 1.200 Euro reduziert werden. Ganz wichtig, die Kosten müssen per Überweisung beglichen werden. Barzahlungen werden vom Finanzamt nicht anerkannt. Als Nachweise werden die Rechnungen und Kontoauszüge verlangt.
Zahlungen von Versicherungen sind abzuziehen
Knapp die Hälfte aller Gebäude ist in Deutschland gegen Hochwasserschäden versichert. Sofern eine Hausrat- oder Gebäudeversicherung vorliegt und diese Schäden abgedeckt sind, hat diese Vorrang. Das gilt auch für die Versicherung gegen Elementarschäden. Leistungen sind erstmal bei der Versicherung einzufordern, bevor ein Abzug beim Finanzamt geltend gemacht werden kann. Damit von der Versicherung möglichst schnell Entschädigungen fließen, muss der Schaden beziffert werden. Fotos als Beweise sind meist notwendig. Im Zweifelsfall muss ein Sachverständiger herangezogen werden.
Ist die Versicherung für den Schaden aufgekommen oder wird ein Ersatzanspruch erwartetet, muss die Höhe der Entschädigungszahlung in der Steuererklärung angegeben werden. Denn es dürfen nur diejenigen Aufwendungen steuerlich angesetzt werden, die tatsächlich selbst getragen wurden. Auch Spenden von Hilfsorganisationen oder Hilfszahlungen vom Staat, die für die Ersatzbeschaffung oder den Wiederaufbau zugeflossen sind, mindern die steuerlich abziehbaren Beträge.
Antrag auf Lohnsteuerermäßigung ist ratsam
Steuerpflichtige erhalten die Steuerentlastung in den genannten Fällen erst frühestens im darauffolgenden Jahr nach Abgabe der Einkommensteuererklärung. Arbeitnehmer können jedoch einen Antrag auf Lohnsteuerermäßigung beim Finanzamt stellen. Die außergewöhnlichen Belastungen können dadurch als Freibetrag in den elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen eingetragen werden. Dann sinkt die monatliche Steuerlast sofort und es bleibt früher mehr Netto vom Brutto.
Steuerbegünstigungen durch den Katastrophenfall
Durch einen Verlust von relevanten Steuerunterlagen sollen keine Steuernachteile entstehen. Wurden Unterlagen zerstört, ist es ratsam, dies zeitnah zu dokumentieren. Um unzumutbare Härten zu vermeiden, können die Vorauszahlungen auf Einkommensteuer reduziert werden. Fällige Steuerforderungen können kurzzeitig ausgesetzt werden. Anträge sind nicht abzulehnen, wenn der Wert der Schäden im Einzelnen nicht wertmäßig nachgewiesen wird. Auf Säumniszuschläge und Vollstreckungsmaßnahmen wird vorübergehend gänzlich verzichtet.
Private Vermieter dürfen ihre Aufwendungen für die Beseitigung von Schäden am Gebäude und Grundstück als Werbungskosten bis zu einer Höhe von 70.000 Euro ohne nähere Prüfung als Erhaltungsaufwendungen in Abzug bringen. Höhere Aufwendungen dürfen auf zwei bis fünf Jahre verteilt werden.
Unterstützt der Arbeitgeber seine Mitarbeiter aufgrund der Katastrophe, sind Beihilfen bis 600 Euro im Jahr steuerfrei. Höhere Beihilfen können in besonderen Härtefällen auch noch steuerfrei sein, was für viele Flutopfer mit Sicherheit zutrifft. Stellt der Arbeitgeber seinen betroffenen Angestellten unentgeltlich eine Wohnung, ein Fahrzeug oder Verpflegung zur Verfügung, so sind diese Unterstützungsleistungen steuerfrei. Selbiges gilt für Zinszuschüsse und Zinsvorteile, wenn der Arbeitgeber dem Mitarbeiter ein Darlehen für den Wiederaufbau gewährt.
Die genauen Details zu den einzelnen Maßnahmen sind den jeweiligen Katastrophenerlässen der Länder und dem Schreiben des Bundesfinanzministeriums zur Flutkatastrophe vom Juli 2021 zu entnehmen, so die Lohnsteuerhilfe Bayern.
Unwetterschäden von der Steuer absetzen
Hunderte Keller liefen voll, Bäume stürzten um, Autos wurden durch Hagel zerstört: Schwere Unwetter haben in den vergangenen Tagen zu enormen Schäden geführt. Immerhin: Betroffene können die Kosten für die Schadensbehebung unter Umständen steuerlich absetzen. Wie das geht und was dabei zu beachten ist, erklärt der Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH).
Die Schäden der vergangenen Tage werden die Versicherer laut Expertenschätzungen mehr als 2,5 Milliarden Euro kosten, wie das Nachrichtenportal Der Spiegel berichtet. Denn in etlichen Fällen springt die Gebäude- oder Hausratversicherung ein. In anderen Fällen hilft eine zusätzliche Elementarschadenversicherung.
Doch was machen all diejenigen, bei denen keine Versicherung zahlt? Für die gibt es unter Umständen die Möglichkeit, die Ausgaben rund um die Schadensbeseitigung von der Steuer abzusetzen. Dabei ist von Bedeutung, in welchem Verhältnis der Betroffene zur Immobilie steht: Selbstnutzer, Vermieter oder Mieter.
1. Vermieter: Unwetterbedingte Reparaturkosten als Werbungskosten absetzen
Ein Vermieter gibt ein seiner Steuererklärung seine Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung an. An dieser Stelle kann er in der Regel auch die notwendigen Ausgaben rund um die Behebung unwetterbedingter Schäden als Werbungskosten geltend machen.
Eine zweite Möglichkeit: Für Wiederherstellungskosten können unter Umständen Sonderabschreibungen infrage kommen, wobei die Gegebenheiten des jeweiligen Einzelfalls zu beachten und am besten von einem Einkommensteuerexperten zu prüfen sind.
2. Selbstnutzer und Mieter: Kosten für die Schadensbeseitigung als außergewöhnliche Belastung absetzen
Kosten, die im Zusammenhang mit Unwetterschäden entstehen, können unter bestimmten Bedingungen als außergewöhnliche Belastungen in die Steuererklärung eingetragen werden. Das gilt auch für Mieter, wenn beispielsweise Schönheitsreparaturen nötig sind, die der Vermieter nicht übernimmt.
Konkret können folgende durch Unwetter hervorgerufene Kosten als außergewöhnliche Belastungen geltend gemacht werden:
- Kosten für Bauarbeiten, Reparaturen oder Instandsetzungsmaßnahmen, die existenziell wichtige Bereiche am Haus oder an der Wohnung betreffen. Gemeint sind damit zum Beispiel zerbrochene Fensterscheiben, kaputte Haustüren oder unterspülte Grundmauern. Personenkraftwagen, Gartenterrassen, Garagen oder Ähnliches werden hingegen nicht als existenziell notwendig angesehen und somit auch nicht berücksichtigt.
- Kosten für die Anschaffung von Möbeln, Hausrat oder Kleidung, die durch die unwetterbedingten Schäden nutzlos geworden sind; sogenannte Vermögensgegenstände wie kostbare Bilder und Antiquitäten oder die wertvolle Briefmarken- bzw. Münzsammlung fallen allerdings nicht darunter. Der Betrag, der in den Notfällen jeweils angesetzt werden kann, orientiert sich immer am sogenannten Zeitwert der unbrauchbar gewordenen Gegenstände. Wichtig ist also, was die irreparabel beschädigten Objekte zum Zeitpunkt der Beschädigung oder Zerstörung noch wert waren. Der Neuwert jener Sachen, die die Betroffenen nach dem Unglück kaufen, ist nicht maßgeblich. In die Steuererklärung eintragen lässt sich ausschließlich der Wiederbeschaffungswert für ein Objekt, das dem kaputtgegangenen Gegenstand in den Kategorien Alter, Art, Wert und Güte gleicht.
Wer solche unwetterbedingten Ausgaben als außergewöhnliche Belastungen geltend machen will, muss folgende Bedingungen beachten:
- Der Schaden darf nicht durch eigenes Verschulden bzw. durch einen Dritten verursacht worden sein. Er muss sich auf ein sogenanntes unabwendbares Ereignis - also zum Beispiel auf Blitzeinschlag, Starkregen, Hagel oder Sturm - zurückführen lassen.
- Betroffene müssen alle Versicherungsmöglichkeiten ausgeschöpft haben: Einen Abzug der Kosten zur Schadensbeseitigung und Wiederbeschaffung lässt der BFH nur zu, wenn es keine Möglichkeit gab, eine "allgemein zugängliche und übliche Versicherung" schließen. Dazu zählen beispielsweise eine Gebäudeversicherung oder Hausratversicherung - nicht aber eine sogenannte Elementarversicherung gegen Überschwemmung, Erdbeben, Erdrutsch.
- Hat das Unwetter-Opfer von einer Versicherung eine Erstattung bzw. andere finanzielle Hilfen erhalten, sind die Schadenskosten um diese Beträge zu kürzen.
- Die Schadensbeseitigung und die Wiederbeschaffung von Zerstörtem sollten in einer gewissen zeitlichen Nähe zum Schadenseintritt stattfinden. Konkret: Das Finanzamt akzeptiert Erwerbungen und Reparaturarbeiten innerhalb von drei Jahren nach dem Unwetterereignis.
- Das Finanzamt kann die Vorlage von Rechnungen und anderen geeigneten Nachweisen verlangen, um die Schadenskosten und deren ordnungsgemäße Begleichung zu belegen.
Gut zu wissen: Bei den außergewöhnlichen Belastungen berechnet der Fiskus zunächst einmal für jeden Einzelnen eine sogenannte zumutbare Eigenbelastung, die sich individuell an der Höhe der Einkünfte, dem Familienstand und der Kinderanzahl orientiert. Erst Kosten, die diese Zumutbarkeitsgrenze überschreiten, wirken sich steuermindernd aus. Neben den unwetterbedingten Kosten fallen zum Beispiel auch Krankheits- oder Kurkosten in die Kategorie der außergewöhnlichen Belastungen.
Katastrophenerlasse sichern Steuererleichterungen
Wüten Unwetter in einer ganzen Region oder in mehreren Regionen, so kann das zuständige Finanzministerium auf diese breitenwirksamen Ereignisse reagieren: Katastrophenerlass lautet das Stichwort in diesem Zusammenhang. Konkret bedeutet das, dass der Fiskus den Geschädigten entgegenkommt, um unbillige Härten zu vermeiden. So können zum Beispiel besondere Steuererleichterungen oder bestimmte vereinfachende Verfahrensregeln beschlossen werden. Gelten solche Erlasse, ist es im Allgemeinen auch leichter, Kosten für die Schadensbeseitigung als außergewöhnliche Belastungen abzusetzen. Grundsätzlich entscheidet das jeweilige Finanzministerium von Fall zu Fall, welche Erleichterungen in welchem Umfang gewährt werden, so der VLH.
Scheidung, Single, Schulden: 7 Tipps zum Steuern sparen
Fast 600.000 Menschen mussten im vergangenen Jahr zur Schuldnerberatung. Betroffen waren vor allem alleinerziehende Frauen und Single-Männer, die meist nach einer Scheidung in finanzielle Not gerieten. Der Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH) gibt Tipps zum Steuern sparen für Geschiedene, Alleinerziehende und Menschen in der Privatinsolvenz.
Fast jede dritte alleinerziehende und überschuldete Frau (29,0 %) sowie jeder fünfte alleinlebende und überschuldete Mann (20,0 %) war im vergangenen Jahr geschieden; Paare ohne Kinder waren hingegen vergleichsweise selten überschuldet, wie das Statistische Bundesamt Anfang Juni mitteilte (Pressemitteilung Nr. 263 vom 7. Juni 2021).
Deshalb hier unsere Empfehlungen für Menschen, die sich scheiden lassen, alleinerziehend sind oder Privatinsolvenz anmelden müssen, um ihre steuerliche Situation zu verbessern:
Geschiedene: Steuerfrei Gewinne ausgleichen, Rente teilen oder Unterhalt erhalten
Der Zugewinnausgleich: Lässt sich ein Paar scheiden und eine/r von beiden hat einen größeren Zugewinn als der/die andere, wird - ohne anderslautenden Ehevertrag - so ausgeglichen, dass am Ende beide Ex-Partner gleich viel Zugewinn haben. Und zwar steuerfrei für beide. In manchen Fällen wird der Zugewinn über eine Immobilie ausgeglichen. Je nachdem, zu welchem Zeitpunkt Sie Ihre Immobilie an einen Dritten verkaufen oder sie Ihrem Ex-Ehepartner übertragen, müssen Sie den Veräußerungserlös versteuern oder können ihn auch steuerfrei vereinnahmen. Deshalb empfiehlt die VLH, sich vor dem Vertragsabschluss steuerlich beraten zu lassen.
Der Versorgungsausgleich: Seit dem 1. September 2009 ist das Gesetz zum Versorgungsausgleich neu geregelt: Lassen sich Eheleute scheiden, wird alles, was während der Ehe für die Altersvorsorge angespart wurde, zusammengerechnet und je zur Hälfte geteilt - und zwar bereits bei der Scheidung. Ausgezahlt wird dann beim Eintritt ins Rentenalter. Damit hat der Gesetzgeber das Prinzip der "internen Teilung" festgelegt, und dadurch bleibt der Ausgleich selbst steuerfrei.
Wie ein Versorgungsausgleich, also eine Teilung der Rentenansprüche bei einer Scheidung, tatsächlich abläuft, entscheidet das zuständige Familiengericht. Es stellt fest, wie lange die Ehe gedauert hat und wie viel währenddessen in die Altersvorsorge eingezahlt wurde. In einem entsprechenden Urteil wird festgelegt, welcher Ehegatte wie viele seiner sogenannten Renten-Entgeltpunkte an den anderen abgeben muss.
Es gibt noch eine andere Möglichkeit, wie Rentenansprüche geteilt werden können: Man zahlt seinen Ex-Ehepartner mit einer einmaligen Summe aus. Dafür wird die spätere Rente nicht geteilt. Hat der Auszahlende einen höheren Steuersatz, kann diese Variante ebenfalls einen Steuervorteil bieten: Er setzt die Zahlung als Sonderausgaben ab - unter der Voraussetzung, dass der Ex-Partner, der den Versorgungsausgleich erhält, mit seiner Unterschrift in der Anlage U zustimmt. Der Ex-Partner wiederum muss das Geld als "sonstige Einkünfte" versteuern.
Unterhaltszahlungen: Bei der Unterhaltszahlung eines Ex-Ehegatten an den anderen ("Ehegattenunterhalt") gibt es sowohl den Trennungsunterhalt für den Zeitraum zwischen der Trennung und der rechtskräftigen Scheidung als auch den nachehelichen Unterhalt, der gegebenenfalls nach der Scheidung gezahlt wird.
Wer diesen Unterhalt zahlt - die Höhe wird vom zuständigen Familiengericht festgesetzt -, hat zwei Möglichkeiten, das Geld in der Steuererklärung einzutragen: Entweder als außergewöhnliche Belastungen oder als Sonderausgaben. Tragen Sie als Unterhaltszahler die Kosten als außergewöhnliche Belastung ein, müssen Sie auch tatsächlich gezahlt haben. Bis zu einem jährlichen Höchstbetrag von 9.408 Euro (Steuererklärung 2020) kann Ehegattenunterhalt abgesetzt werden, sofern Ihre Kosten die zumutbare Eigenbelastung überschreiten. Erzielt der Unterhaltsberechtigte eigene Einkünfte, verringert sich der Höchstbetrag.
Tragen Sie die Unterhaltszahlungen in Ihrer Steuererklärung als Sonderausgaben ein - im Steuerrecht "Realsplitting" genannt -, können Sie bis zu 13.805 Euro pro Jahr absetzen. Voraussetzung des Realsplittings ist, dass der Ex-Partner mit einer Unterschrift in der Anlage U zustimmt und die erhaltenen Unterhaltszahlungen in seiner Steuererklärung (Anlage SO) angibt. Allerdings: Das Realsplitting lohnt sich, wenn die steuerliche Entlastung des zum Unterhalt verpflichteten Partners höher ist als die Mehrbelastung des Unterhaltsempfängers.
Alleinerziehende: Seit 2020 über 4.000 Euro Freibetrag sichern
Freibetrag für Alleinerziehende: Der sogenannte Entlastungsbetrag für Alleinerziehende wurde seit dem Jahr 2020 mehr als verdoppelt: Seither wird für alleinerziehende Väter und Mütter, die ihre Steuererklärung abgeben, ein Freibetrag von 4.008 Euro berücksichtigt. Diesen Entlastungsbetrag zieht das zuständige Finanzamt von den steuerpflichtigen Einkünften des alleinerziehenden Elternteils ab und verringert dadurch die Steuerlast.
Diesen Steuervorteil erhalten Mütter und Väter, die steuerlich gesehen tatsächlich als alleinerziehend gelten, nämlich wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:
- Sie leben mit ihrem Kind in einer gemeinsamen Wohnung.
- Ihnen steht Kindergeld oder der Kinderfreibetrag für das Kind zu.
- Sie sind unverheiratet oder leben seit dem vorangegangenen Veranlagungszeitraum dauernd getrennt, oder sie sind verwitwet.
- Sie leben nicht in einer sogenannten Haushaltsgemeinschaft mit einer anderen volljährigen Person zusammen.
VLH-Ratschlag: Geben Sie Ihre Steuererklärung ab und nutzen Sie den Entlastungsbetrag für Alleinerziehende! Den Freibetrag erhalten Sie als alleinerziehender Vater oder als alleinerziehende Mutter auch dann, wenn Sie mit einem volljährigen Kindern zusammenleben, solange Sie noch Anspruch auf Kindergeld oder einen Kinderfreibetrag haben. Anders ist das, wenn Sie mit Ihrem Lebensgefährten oder Ihrer Lebensgefährtin, der eigenen Mutter, dem Bruder oder mit WG-Genossen in einem Haushalt leben - dann steht Ihnen kein Entlastungsbetrag für Alleinerziehende zu.
Freibeträge für Kinder: Der Kinderfreibetrag steht grundsätzlich jedem Elternteil zu. Bei minderjährigen Kindern kann der Elternteil, in dessen Haushalt das Kind gemeldet ist, eine Übertragung des Freibetrags für Betreuung, Ausbildung und Erziehung vom anderen Elternteil beantragen. Dieser kann allerdings widersprechen, wenn er das Kind in einem "nicht unwesentlichen Umfang" betreut.
Privatinsolvenz: Steuererklärung macht der Insolvenzverwalter - die Kosten lassen sich ggf. absetzen
Durch eine Privatinsolvenz - auch Verbraucherinsolvenz genannt - kann man sich von seinen Schulden befreien. Kurz gesagt geht es dabei um Folgendes: Sie geben einen Teil Ihrer Einkünfte ab und verlieren innerhalb von sechs, fünf oder drei Jahren alle Schulden. Das Insolvenzgericht teilt Ihnen einen sogenannten Insolvenztreuhänder zu. Er verteilt in der Regel das Vermögen des Schuldners an die Gläubiger.
Mindestgebühr für Gericht und Treuhänder absetzen: Bei einer Privatinsolvenz beträgt die Mindestgebühr 2.000 Euro. Die Kosten der Insolvenz selbst richten sich nach der Höhe der Insolvenzmasse. Darüber hinaus können Anwaltskosten hinzukommen; neben Rechtsanwälten gibt es allerdings auch Schuldnerberatungsstellen, die kostenfrei beraten. Außerdem kann ein Schuldner beim Amtsgericht einen Berechtigungsschein einholen, dann übernimmt der Staat einen Teil der Kosten - die Ausgaben für Antragsstellung und Eröffnungsverfahren nicht inbegriffen. Die sogenannte Prozesskostenhilfe gibt es bei Insolvenzverfahren allerdings nicht.
Steuererklärung erstellt der Insolvenzverwalter: Der Insolvenzverwalter ist dazu verpflichtet, Ihre Steuererklärung auszufüllen und einzureichen - und zwar bis zur Aufhebung oder der Beendigung des Insolvenzverfahrens. Der Insolvenztreuhänder muss sogar nicht nur die Steuererklärung für den aktuellen Veranlagungszeitraum erstellen, sondern gegebenenfalls auch für zurückliegende Jahre - und diese unterschreiben. Sie selbst haben dabei eine Mitwirkungspflicht, müssen den Insolvenzverwalter also mit allen notwendigen Informationen versorgen.
Aufpassen müssen vor allem Verheiratete: Bei zusammenveranlagten Paaren unterschreiben der Insolvenzverwalter und der Ehepartner. Kommt es zu einer Steuererstattung, sollte der Ehepartner unbedingt die Aufteilung der Erstattung beantragen. Sonst fließt die komplette Steuererstattung in die Insolvenzmasse, der Ehepartner geht leer aus.
Urteil zur Doppelbesteuerung von Renten: Wem nützt es?
Der BFH hat festgelegt, wie eine doppelte Rentenbesteuerung berechnet werden kann
16 Jahre nach Inkrafttreten der Rentensteuerreform wurden am 31. Mai vom Bundesfinanzhof in München zwei weitreichende Urteile in Anbetracht einer möglichen Doppelbesteuerung von deutschen Renten veröffentlicht. Tobias Gerauer von der Lohi (Lohnsteuerhilfe Bayern) war bei der Urteilsverkündung live vor Ort und wird die Tragweite des Urteils erklären. Obwohl bei beiden Klägern keine Doppelbesteuerung festgestellt wurde, fordern die Urteile eine Nachbesserung des Gesetzgebers für zukünftige Rentnergenerationen. Von dieser Musterklage werden Millionen Rentner profitieren, da ihnen eine Klage erspart bleibt.
Herr Gerauer, welche Jahrgänge werden zukünftig profitieren?
Insbesondere für die Geburtsjahrgänge ab 1972 sollten die Urteile eine Besserung nach sich ziehen. Denn wer 2040 oder später in Rente geht, muss seine Rente vollständig versteuern. So will es momentan das Gesetz. Diese Generationen sind – wie jetzt herauskam – benachteiligt, weil sie ihre Altersvorsorgebeiträge, die sie während ihrer Berufstätigkeit bis 2025 in die Rentenkasse einzahlen, im Gegenzug nicht vollständig steuerlich absetzen können.
Das gerichtliche Credo lautet, dass die erwartete steuerfrei zufließende Rente mindestens so hoch sein muss wie die aus dem versteuerten Einkommen bezahlten Rentenversicherungsbeiträge. Es darf, so der Bundesfinanzhof und zuvor schon das Bundesverfassungsgericht, in keinem Fall zu einer Doppelbesteuerung kommen. Während das System derzeit noch funktioniert, stehen in Zukunft teilweise versteuerten Beiträgen keine steuerfreien Rentenanteile mehr gegenüber.
Wie kam es zu der möglichen Doppelbesteuerung?
Auslöser war eine Verfassungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht, welche die Ungerechtigkeit zwischen der Besteuerung von Renten und Beamtenpensionen anprangerte. Da Pensionäre ihre Bezüge im Alter versteuern müssen, musste eine Anpassung her, entweder die Pensionen weniger besteuern oder die Rentner höher. So entstand das Alterseinkünftegesetz. Mit diesem wurde 2005 beschlossen, die Besteuerung der Renten von vorgelagert auf nachgelagert umzustellen. Wurden früher überwiegend die eingezahlten Rentenbeträge des Arbeitnehmers aufgrund eines geringen Sonderausgabenabzugs besteuert, ist es nun die ausbezahlte Rente.
Allerdings wäre eine sofortige Umstellung der Rentenbesteuerung nicht verfassungsgemäß gewesen, so dass sie fließend über einen Zeitraum von 35 Jahren eingeführt wurde. Bei den aktuellen Urteilen ging es nicht um die nachgelagerte Besteuerung per se, denn die wurde vom Bundesverfassungsgericht bereits geprüft und als verfassungskonform bestätigt. Es ging darum, ob der Staat im Zuge der stufenweisen Umstellung ein Ungleichgewicht für manche Rentner geschaffen hat.
Der steuerfreie Rentenbetrag wird mit jedem Renteneintrittsjahr zurückgefahren. Somit werden ab einem bestimmten Zeitpunkt in Abhängigkeit von der Höhe der Renteneinzahlungen die aus versteuertem Einkommen geleisteten Rentenversicherungsbeiträge nicht mehr kompensiert. Denn die Altersvorsorgeaufwendungen können erst ab 2025 vollständig als Sonderausgaben in der Einkommensteuererklärung abgezogen werden.
Genau hier hakt es: Die Altersvorsorgebeiträge konnten bis 2004 nur im Rahmen von niedrigen Höchstbeträgen und ab 2005 nur teilweise steuerlich geltend gemacht werden. Während des Berufslebens wird in der Regel aber länger als 15 Jahre in die Altersvorsorge eingezahlt. Somit ist eine Überschneidung über das ganze Erwerbsleben hinweg möglich. Dies führt zu einem Ungleichgewicht von steuerfreien Ein- und Auszahlungen.
Wie wird eine Doppelbesteuerung festgestellt?
Das ist schwierig! Allerdings hat der BFH erstmals genaue Berechnungsvorgaben gemacht. Bisher hat das Finanzamt neben dem Rentenfreibetrag verschiedene Posten dem steuerfreien Betrag zum Nachteil der Rentner eingerechnet. Damit wurde die steuerfreie Summe in die Höhe getrieben und die Hürde für die Doppelbesteuerung höher gelegt. Ab sofort dürfen der Grundfreibetrag, die Werbungskostenpauschale und die Beiträge zur Krankenversicherung nicht mehr eingerechnet werden.
Der so berechnete jährliche Rentenfreibetrag wird anschließend mit der voraussichtlichen Lebenserwartung multipliziert. Bei der Lebenserwartung wird die Sterbetafel des Statistischen Bundesamt benutzt, da die tatsächliche Lebenserwartung vorab nicht bekannt ist. So ergibt sich die gesamte steuerfrei zufließende Rente. Bei Ehegatten muss eine mögliche Hinterbliebenenrente noch dazu gerechnet werden.
Auf der anderen Seite muss für jedes Beitragsjahr, in dem die Versicherungsbeiträge einbezahlt wurden, ermittelt werden, wie hoch die Beiträge waren, die nicht als Sonderausgaben berücksichtigt wurden. Das heißt, es muss für das gesamte Erwerbsleben, also Jahrzehnte zurück, nachgerechnet werden. Das ist kompliziert, weil sich die abziehbaren Beträge geändert haben und zwischen den unterschiedlichen Sozialversicherungskomponenten und Ehegatten verhältnismäßig aufgeteilt werden müssen.
Die Summe der Beiträge, für die kein Sonderausgabenabzug in Frage kam, wird anschließend mit den steuerfrei zufließenden Renten verglichen.
Was ändert sich durch die neue Urteilsverkündung?
Aufgrund dieses Urteils werden einige Rentnergruppen bessergestellt. Sie sind durch ihre persönlichen Umstände eher von einer Doppelbesteuerung betroffen. Das sind Unverheiratete, da bei ihnen keine Hinterbliebenenansprüche einkalkuliert werden müssen, Selbstständige, die in der Regel aus ihrem Nettoeinkommen die Altersvorsorge bestreiten und Männer im Allgemeinen aufgrund ihrer kürzeren Lebenserwartung.
Rentner, die in den vergangenen Jahren einen Einspruch beim Finanzamt mit dem Verdacht auf Doppelbesteuerung eingelegt haben, müssen nun aufgrund der geänderten Berechnungsparameter eine Berechnung durchführen. Sollte sich herausstellen, dass eine doppelte Besteuerung vorliegt, können sie eine Steuerrückzahlung erhalten. Das Problem liegt aber auf der Hand: Der Rentner muss mit seinen Unterlagen und durch eine Berechnung nachweisen, dass eine Doppelbesteuerung der Rente vorliegt. In künftigen Fällen macht ein Einspruch nur dann Sinn, wenn man die Doppelbesteuerung tatsächlich nachweisen kann.
28 Millionen Deutsche machen ihre Steuererklärung im Internet
Die elektronische Steuererklärung wird zunehmend beliebter. Im vergangenen Jahr entschieden sich besonders viele für den digitalen Weg zum Finanzamt, statt die Dokumente zum Briefkasten zu bringen: 28,2 Millionen Menschen reichten ihre Einkommensteuererklärung für das Steuerjahr 2019 online ein. Das ist ein Anstieg um 19 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als es 23,8 Millionen Online-Steuererklärungen waren. Dies berichtet der Digitalverband Bitkom auf Basis von Daten der Finanzverwaltung, die den Online-Dienst Elster betreibt. „Die elektronische Steuererklärung Elster ist das Paradebeispiel dafür, dass und wie digitale Verwaltung auch in Deutschland funktioniert: Ein zentraler Ansatz durch den Bund und alle machen mit“, sagt Bitkom-Präsident Achim Berg. Ein Vorteil: Aufwand und Eingabefehler verringern sich. Außerdem werden elektronische Steuererklärungen bevorzugt bearbeitet, sodass Steuerpflichtige schneller an ihre Rückerstattung kommen. Die Zahl der Steuererklärungen wird sich für das Corona-Steuerjahr 2020 im Verhältnis zum Vorjahr noch einmal erhöhen. Ein Grund dafür ist die stark gestiegene Anzahl von Menschen, die Kurzarbeitergeld bezogen haben. Diese sind zur Abgabe einer Steuererklärung verpflichtet.
Steuererleichterungen für das Corona-Jahr 2020
Neben mehr Pflicht-Abgaben von Steuererklärungen gibt es verschiedene Neuerungen, die im Rahmen der Corona-Pandemie eingeführt wurden und Anreize schaffen, auch auf freiwilliger Basis eine Steuererklärung einzureichen. So können Bürgerinnen und Bürger von diversen Steuererleichterungen profitieren. Beispielsweise ist die sogenannte Homeoffice-Pauschale interessant, die es Steuerpflichtigen ermöglicht, pro Tag pauschal 5 Euro (max. 600 Euro im Jahr) abzusetzen, auch wenn die Arbeit z. B. am Küchentisch, also ohne getrenntes häusliches Arbeitszimmer durchgeführt wurde. Fernpendler können zudem die BahnCard 100 komplett absetzen, wenn glaubhaft nachgewiesen werden kann, dass diese Corona-bedingt für berufliche Zwecke nicht oder kaum genutzt wurde. Alle Infos zu den Änderungen hat das Bundesfinanzministerium in einer FAQ-Liste zusammengefasst.
Fristverlängerungen durch Corona
Nicht nur Steuererleichterungen wurden angesichts der Corona-Pandemie beschlossen, auch die Abgabefrist für Einkommensteuererklärungen für 2020 hat der Bundestag verlängert. Die allgemeine Frist, die 2019 bereits um zwei Monate bis Ende Juli ausgedehnt wurde, endet für das vergangene Steuerjahr nun am 31. Oktober 2021. Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, deren Steuererklärung von einem Steuerberater bzw. einer Steuerberaterin oder einem Lohnhilfesteuerverein erstellt werden, haben sogar bis Ende Mai 2022 Zeit, diese abzugeben – also ebenfalls drei Monate später. Steuerberatungen werden zudem zusätzlich entlastet und müssen Steuererklärungen für 2019 ausnahmsweise erst bis Ende August 2021 abgeben. Normalerweise drohen bei Fristüberschreitungen empfindliche Strafen. Aufgrund der Corona-Pandemie sind die Finanzämter jedoch dazu angehalten, auf Verspätungszuschläge zu verzichten. Die Verlängerung der Erklärungsfrist wirkt sich auch auf andere Fristen entsprechend aus, wie die auf Zinsen, Verspätungszuschläge und Einkommensteuervorauszahlungen. Der Fristverlängerung muss der Bundesrat Ende Juni noch zustimmen.
Verschiedene Wege zur Online-Steuererklärung
Für den digitalen Weg zur Steuererklärung kann man zwischen mehreren Möglichkeiten wählen: über den Browser, mit einer Software zum Download oder über mobile Apps. Eine steigende Anzahl an kommerziellen Anbietern bringt derzeit Lösungen für die Online-Steuererklärung auf den Markt. Dabei setzen sie besonders auf Nutzerfreundlichkeit und geben zusätzlich Steuertipps. Die Kosten für das Programm können dann von der Steuer abgesetzt werden. Eine kostenfreie, aber etwas kniffligere Alternative für die elektronische Durchführung der Steuererklärung bietet die Finanzverwaltung über das Online-Portal „Mein Elster“. Dazu bedarf es einer einmaligen Registrierung und postalischen Authentifizierung, die einige Tage beansprucht. Download und Installation einer Software sind nicht nötig. Das Elster-Formular zum Download für eine offline Bearbeitung ist seit diesem Jahr nicht mehr verfügbar. Der Umstieg zu „Mein Elster“ ist jedoch in wenigen Schritten vollzogen.
Steuererleichterungen für Ehrenamtliche und Vereine
Das freiwillige Engagement der Bürger ist ein elementarer Baustein unserer Gesellschaft und bekommt jetzt nach dem Lockdown wieder Aufwind. 31 Millionen Ehrenamtliche sorgen in Deutschland für gesellschaftlichen Zusammenhalt, soziale Bindungen und steigern die Lebensqualität hierzulande. Die Bundesregierung hat daher das Ziel, das ehrenamtliche Engagement weiter zu stärken. Dazu hat sie die Steuervorteile für ehrenamtliche Helfer und gemeinnützige Vereine ab 1. Januar 2021 verbessert und den Spendennachweis erleichtert, so die Lohnsteuerhilfe Bayern.
Erhöhung der Ehrenamtspauschalen
Der Übungsleiterfreibetrag wurde um 600 Euro auf 3.000 Euro pro Jahr angehoben. Bis zu dieser Höchstgrenze sind Einnahmen aus nebenberuflichen Übungsleitertätigkeiten nicht zu versteuern. Zu solchen Tätigkeiten zählen z.B. Trainer in Sportvereinen, Leiter von Freizeitchören, Ausbilder bei der Freiwilligen Feuerwehr oder Dozenten an einer Volkshochschule. Auch andere gemeinnützige Tätigkeiten werden ab diesem Jahr steuerlich besser gefördert. Eine pauschale Erstattung finanzieller Aufwendungen ist ab sofort bis zu einem Höchstbetrag von 840 Euro pro Jahr für ehrenamtliche Helfer steuerfrei. Bisher lag der steuerfreie Maximalbetrag bei 720 Euro.
Erweiterung der gemeinnützigen Zwecke
Die Abgabenordnung beinhaltet eine Liste von Zwecken, die steuerlich begünstigt sind. Diese Liste wurde um verschiedene Begriffe wie Klimaschutz, Friedhofspflege, Ortsverschönerung, Freifunk und Hilfe für Menschen, die aufgrund ihrer geschlechtlichen Identität diskriminiert werden, erweitert. Vereine und Körperschaften und Zweckbetriebe mit solchen Aufgaben werden nun als gemeinnützig und förderfähig anerkannt. Damit Verbraucher die Gemeinnützigkeit überprüfen können, wird ein zentrales Zuwendungsempfängerverzeichnis beim Bundeszentralamt für Steuern geschaffen. Geplant ist die Einführung des Registers ab 2024.
Vereinfachter Spendennachweis heraufgesetzt
Wird für steuerbegünstigte Zwecke gespendet, so ist seit Jahresanfang bis zu einer Spende in Höhe von 300 Euro nur ein vereinfachter Zuwendungsnachweis notwendig. Mit dem Jahressteuergesetz 2020 wurde die Grenze von 200 auf 300 Euro angehoben. Das bedeutet, dass bis zu diesem Betrag keine Spendenbescheinigung des Empfängers erforderlich ist, sondern z.B. der Kontoauszug über die Zahlung als Beleg für das Finanzamt ausreicht. Bereits seit 2017 gilt, dass der Beleg nicht mit den Steuerunterlagen eingereicht, sondern nur vorgehalten werden muss, falls ein Nachweis vom Finanzbeamten nachgefragt wird, so die Lohnsteuerhilfe Bayern.
Notebook, Tablet und Co: steuerliche Nutzungsdauer auf 1 Jahr verkürzt
Der technologische Fortschritt schreitet immer schneller voran. Die Innovationszyklen werden zunehmend kürzer. Kaum hat man sich z.B. ein Notebook angeschafft, ist es fast schon wieder veraltet. Die nächste Generation ist flacher, schneller und mächtiger. Auch die Nutzung moderner Kommunikationstechnologien nimmt stetig zu. Während der Corona-Pandemie ist sie so stark wie noch nie angestiegen. Die Nachfrage nach Notebooks, Tablets und Smartphones war gigantisch. Aus diesem Anlass hat das Bundesministerium für Finanzen die Nutzungsdauer von Computern und allem, was dazu gehört, im Steuerrecht auf ein Jahr herabgesetzt.
Wer seine angeschafften Geräte beruflich nutzt, kann diese ab dem Veranlagungsjahr 2021 vollständig im Jahr des Kaufes absetzen, so die Lohnsteuerhilfe Bayern.
Betrifft Arbeitnehmer im Home-Office
In den Corona-Jahren 2020 und 2021 haben viele Arbeitnehmer im Homeoffice die notwendigen technischen Geräte für ihren Arbeitsplatz zu Hause angeschafft. Bisher mussten PCs, Drucker und Software mit einem Anschaffungspreis über 800 Euro netto über den Zeitraum von drei bis fünf Jahren abgeschrieben werden. Der Kaufpreis wurde also auf mehrere Steuererklärungen aufgeteilt. Dem liegt die AfA-Tabelle zur Abschreibung für allgemeine Anlagegüter zugrunde. Die Finanzverwaltung hat die steuerlichen Abschreibungsregelungen nun geändert. Ab dem 1. Januar 2021 wird nur mehr eine gewöhnliche Nutzungsdauer von einem Jahr angenommen. Dies gilt auch rückwirkend für noch nicht vollständig abgeschriebene Geräte.
Sofortabschreibung setzt sich durch
Unabhängig von seiner Höhe kann jetzt der volle Kaufpreis in einem Zug von Arbeitnehmern und Unternehmern von der Steuer abgesetzt werden. Eine Pflicht zur Sofortabschreibung besteht jedoch nicht. Die Änderung dieser Steuervorschrift betrifft eine Vielzahl an Käufen, von Computerhardware über Peripheriegeräte und Zubehör bis hin zu Betriebs- und Anwendersoftware. Darunter fallen PCs, Notebooks, Workstations, Dockingstations, Small-Scale-Server, Laufwerke, externe Speicher, Netzteile, Tastaturen, Mäuse, Tablets, Kameras, Mikrofone, Lautsprecher, Headsets, USB-Sticks, Streamer, Beamer, Plotter, Drucker und Monitore.
Steuervorteil leichter zu erzielen
Wird die Technik mindestens zu 90 Prozent beruflich genutzt, ist die vollständige Abschreibung des Kaufpreises als Werbungskosten erlaubt. Beträgt der private Nutzungsanteil mehr, so ist zwischen privater und beruflicher Nutzung abzugrenzen. Nur der berufliche Anteil ist gemessen am Kaufpreis absetzbar. Nutzt jemand seinen Laptop beispielsweise zu 50 Prozent beruflich, kann er entsprechend nur die Hälfte der Kosten beim Finanzamt geltend machen.
Im Übrigen empfiehlt es sich, vom Arbeitgeber eine Bestätigung über die berufliche Nutzung einzuholen, falls das Finanzamt einen Nachweis anfordert. Was die Steuererklärung betrifft, ist das Absetzen von IT-Ausgaben durch die Änderung schneller möglich und durch die weggefallene Verteilung auf mehrere Jahre einfacher und unter Umständen rentabler geworden. Wer die Kosten nicht splitten muss, hat eine höhere Wahrscheinlichkeit, die 1000-Euro-Marke der Werbungskostenpauschale zu knacken.
Smartphones ausgeschlossen
Obwohl die Nutzung von Smartphones in 2020 durch Corona übermäßig stark angestiegen ist, wurden Smartphones bei der Modernisierung des Steuerrechts nicht einbezogen. Auch im Zuge von Homeoffice können beruflich mitgenutzte Handys nur bis zu einem Kaufpreis von 800 Euro netto sofort abgeschrieben werden. Liegt der Kaufpreis darüber, bleibt die vom Finanzamt vorgeschriebene, aber ebenfalls nicht mehr zeitgemäße Nutzungsdauer von fünf Jahren erhalten. Die Kosten sind dann über fünf Jahre verteilt in der Steuererklärung anzusetzen, so die Lohnsteuerhilfe Bayern.
Rentner aufgepasst: Bei zu spät oder nicht abgegebener Steuererklärung droht ein Verspätungszuschlag
Viele Rentenbezieher erhalten unerwartet Post vom Finanzamt. Die Steuerbehörde fordert darin zur Abgabe einer Steuererklärung auf. Für viele Rentner kommt diese Nachricht vollkommen überraschend. Üblicherweise wird eine recht kurze Frist gesetzt, bis zu der man die Steuererklärung abgeben muss. In Deutschland müssen rund 75 Prozent aller Rentner keine Steuern zahlen. Viele gehen davon aus, dass sie deshalb auch nicht zur Abgabe einer Steuererklärung verpflichtet sind. Doch auch wer keine Steuern zahlen muss, kann unter Umständen zur Abgabe einer Steuererklärung verpflichtet sein.
Maßgeblich für die Abgabepflicht ist der Gesamtbetrag der Einkünfte, also bei Rentnern der Betrag, der übrig bleibt, wenn man von der gesetzlichen Rente den Rentenfreibetrag und die Werbungskostenpauschale von 102 Euro abzieht. Im Veranlagungszeitraum 2020 lag der Grenzwert für Einzelveranlagung bei 9.408 Euro (2019: 9.168 Euro), im Falle einer Zusammenveranlagung bei 18.816 Euro (2019: 18.336 Euro).
Überschreitet man mit seinen Einkünften den Grundfreibetrag, heißt das noch nicht, dass man gleich vom Fiskus zur Kasse gebeten wird. Auch bei Überschreitung des Grundfreibetrags kann die Steuer am Ende immer noch 0 Euro betragen. Denn auch Rentner profitieren neben dem Rentenfreibetrag und dem steuerlichen Grundfreibetrag von zusätzlichen Abschreibungsmöglichkeiten wie dem Abzug von Krankenversicherungsbeiträgen, Spenden, Krankheitskosten oder dem Behindertenpauschbetrag, wenn ein Grad der Behinderung vorliegt.
Fein raus dank NV-Bescheinigung?
Auch wer eine gültige Nichtveranlagungsbescheinigung besitzt, sollte die Höhe der Einkünfte jährlich überprüfen. Werden durch Rentenanpassungen die Grenzbeträge überschritten, muss man das Finanzamt darüber informieren und leider auch wieder eine Einkommensteuererklärung abgeben.
Darüber hinaus entsteht für alle Rentner eine Abgabepflicht, sobald das Finanzamt zur Abgabe einer Einkommensteuererklärung gemäß § 149 Abs. 1 S. 2 AO aufgefordert hat. Das kommt regelmäßig vor, weil das Finanzamt die elektronisch von der Rentenversicherung übermittelten Beträge mit Verzögerung prüft.
Droht eine Strafe?
Beträgt die Steuer 0 Euro, braucht man sich zumindest keine Sorgen um eine nicht eingeplante Steuernachzahlung oder Nachzahlungszinsen machen. Das Finanzamt kann aber trotzdem einen sogenannten Verspätungszuschlag verlangen. Zwar wird dieser nicht automatisch mit dem Mindestsatz von 25 Euro pro verspäteten Monat berechnet, weil das Finanzamt das bei einer Steuer von 0 Euro nicht darf. Dennoch gibt es Finanzämter, die dann individuell entscheiden, ob ein Verspätungszuschlag gezahlt werden soll. „Gegen so einen Verspätungszuschlag sollte man auf jeden Fall Einspruch einlegen“, empfiehlt Tobias Gerauer, Steuerrechtsexperte der Lohi - Lohnsteuerhilfe Bayern. Es bestehe keine Rechtfertigung dafür, Rentnerinnen und Rentner zu bestrafen, wenn keine Steuer festzusetzen ist.
Unwissenheit schützt doch vor Strafe.
Eine Sonderregelung kann Rentner vor unerwarteten Gebührenforderungen (§ 152 Abs. 5 S. 3 AO) schützen. Wenn die Rentenbezieher nichts von der Abgabepflicht gewusst haben und bis zur Aufforderung durch das Finanzamt von einer Nichtabgabeverpflichtung ausgehen konnten, kommt ein Verspätungszuschlag zunächst nicht in Betracht. Nach einem Aufforderungsschreiben durch das Finanzamt können sich Rentenbezieher jedoch nicht mehr verlässlich auf diese Regelung beziehen.
Expertentipp:
Wer eine fristgerechte Steuererklärung abgibt, ist in jedem Fall auf der sicheren Seite. Tobias Gerauer rät: „Rentenbezieher sollten am besten jährlich prüfen, ob sie eine Steuererklärung abgeben müssen. Nur so erspart man sich sicher den Ärger mit dem Finanzamt.“ Bei der Prüfung und Erstellung helfen Lohnsteuerhilfevereine. Im Rahmen ihrer Befugnis nach § 4 Nr. 11 StBerG beraten sie ihre Mitglieder in Steuerfragen, prüfen jährlich die Voraussetzungen einer Pflichtveranlagung und übernehmen die Korrespondenz mit den Finanzämtern.
Was Vermieter alles von der Steuer absetzen können
Im Vergleich mit anderen EU-Ländern sind die Deutschen Weltmeister, wenn es um das Vermieten von Immobilien geht. Rund 60 Prozent aller Mietwohnungen werden von Privatpersonen vermietet. Die derzeitigen Miethöchstpreise in vielen deutschen Städten bringen attraktive Einkünfte. Und nicht nur das, Vermieter können fast alle Ausgaben rund um die Immobilie bei der Einkommensteuer mit den Mieteinnahmen verrechnen.
"Jegliche Ausgaben, die mit einer Vermietung zusammenhängen, können unabhängig davon, ob es sich um Betriebskosten handelt, die auf den Mieter umgelegt werden dürfen, abgesetzt werden", erklärt Hans Daumoser, Vorstand der Lohnsteuerhilfe Bayern e. V. (Lohi). Werden Kosten auf den Mieter umgelegt, gelten die Zahlungen des Mieters als Einnahmen, die Ausgaben dürfen aber dennoch als Werbungskosten abgesetzt werden.
Suche nach einem Mieter
Um einen passenden Mieter zu finden, wird teilweise ein Makler mit der Suche beauftragt. Andere kümmern sich selbst darum, einen Mieter zu finden und schalten in der Tageszeitung oder im Internet Inserate. Jegliche Ausgaben, die getätigt wurden, um einen Mieter zu bekommen, dürfen in die Werbungskosten rein. Dazu zählen auch die Kosten für einen Energieausweis, den der Mieter verlangen darf.
Unterhalt der Immobilie
Da Mieter mit ihrer Wohnung möglichst wenig Arbeit haben möchten und der Vermieter in der Pflicht ist, sich zu kümmern, fallen Überprüfungen, Wartungen oder Reinigungsarbeiten ihm zu. Es geht um Feuerlöscher, Rauchmelder, Kanalisation, Dachrinnen, Gas-, Wasser- und Heizungsanlagen. Die Kosten für die fachmännische Durchführung der Arbeiten kann der Vermieter absetzen - auch die Kosten für einen Hausmeister, Kaminkehrer, die Müllabfuhr, den Winterdienst und die Gartenpflege. Kanalgebühren, Kabelanschluss und die Grundsteuer sollten bei der Einkommensteuererklärung ebenfalls nicht vergessen werden.
Steht die Wohnung kurzfristig leer, weil renoviert oder kein passender Mieter gefunden wird, dürfen die laufenden Aufwendungen dennoch abgesetzt werden, sofern nachweislich die Absicht zu vermieten besteht.
Gute Mieter - schlechte Mieter
Gibt es Streitigkeiten mit dem Mieter oder einer beauftragten Handwerkerfirma, die einen Gang vor's Gericht erfordern, können die Anwaltsgebühren und Prozesskosten ebenfalls als Werbungskosten angesetzt werden. Muss der Mieter per Beschluss ausziehen, können die Kosten für eine Räumung, Wohnungsreinigung und Renovierung abgesetzt werden. Ist das Verhältnis hingegen gut und der Vermieter lädt seine Mieter oder den Hausmeister zum Essen ein, können Bewirtungskosten zu 70 Prozent abgesetzt werden.
Verwaltungs- und Beratungskosten
Für das Aufsetzen des Mietvertrags, die Mitteilung einer Mieterhöhung oder die Nebenkostenabrechnung werden Büromaterial und Porto verbraucht. Diese Kosten dürfen gemeinsam mit den Ausgaben für Telefonate, Kontoführungsgebühren für ein Extra-Konto, Fachliteratur oder spezielle Software in der Steuererklärung angerechnet werden. Die Kosten für einen PC werden regelmäßig erst dann anerkannt, wenn es sich um mehrere Immobilien handelt, die verwaltet werden müssen. Werden diese Aufgaben an eine Verwalterfirma übergeben, können diese Gebühren angesetzt werden.
Absetzen von Fahrten
Alle Fahrten zur Mietwohnung, um die Wohnung zu besichtigen, herzuzeigen oder handwerkliche Arbeiten vorzunehmen, können mit 30 Cent je gefahrenen Kilometer abgerechnet werden. Genauso die Fahrtkosten zu einem Makler, zur Bank, zur Eigentümerversammlung oder beispielsweise einem Baumarkt, um einen Ersatzduschkopf oder Streusalz für das Mietobjekt zu besorgen.
Ist der Standort der Immobilie weit vom Wohnort des Vermieters entfernt, dürfen die Übernachtungskosten und eine Verpflegungspauschale angesetzt werden. Nachweise, wie Rechnungen oder ein Fahrtenbuch, sollten vorliegen.
Vermieterschutz und Steuererklärung
Wird ein Lohnsteuerhilfeverein oder Steuerberater mit der Erstellung der Steuererklärung beauftragt, können die Mitgliedsgebühr bzw. die Beratungskosten anteilig ansetzt werden. Die Mitgliedsbeiträge für den Haus- und Grundbesitzerverein oder sämtliche Versicherungen, die für die Immobilie oder Vermietung abgeschlossen werden, sind hingegen voll absetzbar.
Sind die Werbungskosten der Anlage V bei der Einkommensteuererklärung höher als die Mieteinnahmen, so macht der Vermieter einen Verlust mit seiner Immobilie. Dieser lässt sich mit dem Arbeitslohn oder anderen Einkünften verrechnen und senkt die verbleibende Steuerlast. Da Vermieter zahlreiche Steuervorteile in Anspruch nehmen können und eine vollständige Aufzählung nicht möglich ist, ist es durchaus empfehlenswert, einen Steuerspezialisten in Anspruch zu nehmen, der sich im Detail auskennt und das Maximum an Steuerersparnissen herausholen kann.
Sieben große Steuer-Irrtümer
Die Kosten fürs Auto kann man absetzen und Arbeitnehmer dürfen maximal 1.000 Euro im Jahr an beruflichen Ausgaben angeben, Mieter können keine Handwerkerkosten absetzen und eine Steuererklärung ist nichts als lästig: Diese und ähnliche Steuermythen sind weit verbreitet. Der Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH) zeigt die gängigsten Irrtümer - und was tatsächlich absetzbar ist.
Steuer-Irrtum 1: Die Kosten fürs Auto kann man von der Steuer absetzen
Kfz-Steuer, Haftpflichtversicherung und eine Teil- oder Vollkasko-Autoversicherung, das sind die üblichen Haltungskosten für einen Autobesitzer. Wer immer mal wieder Kollegen mitnehmen will, kann außerdem eine Zusatzversicherung für Insassen abschließen. Je nach Alter, Größe, Motorisierung und Umweltverträglichkeit des eigenen Pkw kommen für all das mehrere hundert Euro im Jahr zusammen. Viele - vor allem Fahranfänger - denken, dass man diese Haltungskosten fürs Auto von der Steuer absetzen kann.
Stimmt teilweise: Nur die Kosten der Kfz-Haftpflichtversicherung und die Insassen-Unfallversicherung darf man absetzen. Sie gelten im Steuerrecht als "sonstige Vorsorgeaufwendungen", genau wie die Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung. Das Problem bei diesen sonstigen Vorsorgeaufwendungen: Singles dürfen nur maximal 1.900 Euro dieser Kosten jährlich absetzen, Ehepaare und Lebenspartner den doppelten Wert.
Der Höchstbetrag von 1.900 Euro für Singles bzw. 3.800 Euro für Ehepaare und Lebenspartner wird allerdings oft schon mit der Basiskranken- und gesetzlichen Pflegeversicherung erreicht. Die Kfz-Haftpflichtversicherung und die Insassen-Unfallversicherung wirken sich dann gar nicht mehr aus. Und die Kfz-Steuer oder Teil- bzw. Vollkasko darf man erst gar nicht in die Steuererklärung eintragen, denn die Kosten dafür sind nicht absetzbar.
Steuer-Irrtum 2: Nur Vermieter können Handwerkerkosten absetzen
Das Bad renovieren, den Herd anschließen oder die Kinderzimmer streichen lassen: Wer sein Zuhause in Schuss halten will, hat ständig zu tun. Und wer nicht alles selbst machen kann oder will, beauftragt dafür Handwerker. Viele denken allerdings, dass nur Vermieter die Kosten dafür von der Steuer absetzen können.
Stimmt nicht: Jeder kann bis 20 Prozent seiner Handwerkerkosten im Jahr absetzen - egal, ob er zur Miete wohnt oder in seiner eigenen Wohnung bzw. im eigenen Haus. Allerdings gilt eine Obergrenze von 1.200 Euro im Jahr. Darin mit inbegriffen sind Arbeitslohn, Fahrt- und Maschinenkosten der Handwerker, nicht aber die Materialkosten.
Für Mieter und Eigentümer gilt daher: Alle Handwerker-Rechnungen per Überweisung zahlen, beides - Rechnung und Überweisungsbeleg - aufbewahren, alle Kosten für Handwerkerleistungen zusammenrechnen und im Mantelbogen auf Seite 3 eintragen.
Steuer-Irrtum 3: Mieter können keine Nebenkosten absetzen
Je nachdem ob man im Einfamilienhaus oder einer größeren Wohnanlage mit vielen Parteien lebt, fallen mehr oder weniger Nebenkosten für eine Immobilie an. Zu diesen Nebenkosten zählen zum Beispiel die Ausgaben für Hausmeisterdienste, Müllentsorgung, Hausreinigung, Winterdienste oder Dachrinnenreinigung. Viele glauben, dass nur Vermieter derartige Nebenkosten von der Steuer absetzen können.
Stimmt nicht: Auch Mieter dürfen diese Kosten in ihrer Steuererklärung eintragen, die als haushaltsnahe Dienstleistungen gelten. Die konkrete Höhe seiner Kosten entnimmt ein Mieter der Betriebskostenabrechnung, die er einmal im Jahr erhalten sollte.
Wichtig: Arbeitskosten und Materialkosten müssen getrennt aufgeführt sein, denn das Finanzamt begünstigt nur die Arbeitskosten und zwar maximal 4.000 Euro im Jahr.
Steuer-Irrtum 4: Arbeitnehmer dürfen maximal 1.000 Euro Werbungskosten im Jahr absetzen
Die Fahrt zur Arbeit, das Arbeitszimmer zu Hause, das Fortbildungsseminar, die Reisekosten bei einer Dienstreise oder die Berufskleidung - all das und noch etliches mehr zählt zu den Werbungskosten. Das sind Kosten, die Arbeitnehmer im Zusammenhang mit ihrem Beruf hatten und von der Steuer absetzen dürfen. Viele glauben, dass es für diese beruflichen Ausgaben eine Grenze gibt, nämlich maximal 1.000 Euro im Jahr.
Stimmt nicht: Jeder Arbeitnehmer kann so viele Werbungskosten von der Steuer absetzen, wie er tatsächlich übers Jahr hatte. Deshalb sollte jeder Berufstätige seine Quittungen und Kassenzettel für Arbeitskleidung, Bustickets und all die anderen beruflichen Ausgaben aufheben, am Jahresende zusammenzählen und in Anlage N der Steuererklärung eintragen.
Die Summe von 1.000 Euro haben wohl deshalb viele im Kopf, weil der Staat jedem Arbeitnehmer pauschal 1.000 Euro im Jahr als Werbungskosten zuerkennt. Das bedeutet, dass das Finanzamt immer automatisch 1.000 Euro vom Jahreseinkommen abzieht, auch wenn ein Arbeitnehmer weniger Kosten hatte. Für diese Werbungskostenpauschale muss man lediglich die Steuererklärung abgeben, aber nirgendwo ein Kreuzchen machen oder eine Summe eintragen. Doch schon wer jeden Tag 16 Kilometer zu seiner Arbeit fährt, kommt allein mit seinen Fahrtkosten - 30 Cent pro Kilometer und einfache Strecke - über die Pauschale von 1.000 Euro.
Übrigens: Auch Rentner können Werbungskosten absetzen - entweder über die Werbungskostenpauschale in Höhe von 102 Euro, die das Finanzamt jedem Rentner automatisch zuerkennt; oder indem sie ihre Werbungskosten einzeln nachweisen. Was kann das sein? Zum Beispiel Ausgaben, die im Zusammenhang mit der Beantragung der Rente entstanden sind, Kreditzinsen für die Nachzahlung von Rentenversicherungsbeiträgen oder auch die Kosten für einen Renten- oder Versicherungsberater.
Steuer-Irrtum 5: Kinderbetreuungskosten sind nicht absetzbar
Die Jüngere geht zur Tagesmutter, der Große in den Kindergarten und beide werden regelmäßig vom Babysitter betreut. Da kommt der ein oder andere Euro an Betreuungskosten zusammen. Viele denken, dass Eltern nichts davon steuerlich absetzen können.
Stimmt nicht: Leben die Kinder im Haushalt, sind die Kosten für die Kinderbetreuung als Sonderausgaben absetzbar, zum Beispiel für einen Platz in einem Kindergarten oder ein Au-Pair. Das gilt bis zum 14. Lebensjahr eines Kindes und zwar bis zu zwei Drittel der Kosten und maximal 4.000 Euro pro Kind und Jahr.
Wichtig dabei ist Folgendes: Es muss eine Rechnung über die Kosten der Kinderbetreuung vorliegen und diese per Überweisung beglichen worden sein. Barzahlungen erkennt das Finanzamt nicht an. Nicht absetzbar sind die Kosten für beispielsweise Essensgeld oder Spielgeld, weshalb bei der Rechnung die Betreuungskosten extra ausgewiesen werden sollten.
Gut zu wissen: Wer die Großeltern bittet, auf die Enkel aufzupassen, kann ihnen die Fahrtkosten erstatten und dann mit 30 Cent pro Kilometer in der eigenen Steuererklärung angeben. Das gilt auch dann, wenn Oma und Opa kein Geld fürs Kinderhüten nehmen.
Steuer-Irrtum 6: Rentner müssen erst dann eine Steuererklärung abgeben, wenn sie vom Finanzamt angeschrieben werden
Seit 1. Januar 2005 ist das Alterseinkünftegesetz in Kraft. Kurz zusammengefasst bedeutet dieses Gesetz, das Rentner einen immer größer werdenden Teil ihrer Rente versteuern müssen. Wie viel Rente das ist, hängt vom Jahr des Renteneintritts ab. Wer 2005 und früher in Rente gegangen ist, muss 50 Prozent seiner Rente versteuern, ab 2019 sind es 78 Prozent und ab 2040 wird jeder Rentner seine Rente zu 100 Prozent versteuern müssen.
Dennoch hat nicht automatisch jeder Rentner auch eine Steuererklärung abzugeben. Das Finanzamt verlangt erst dann eine Steuererklärung, wenn der steuerpflichtige Teil der Jahresbruttorente über dem Grundfreibetrag liegt. Dieser Grundfreibetrag wird vom Gesetzgeber immer mal wieder angepasst; vielleicht ist das der Grund, warum viele denken, dass das Finanzamt sich schon melden wird, wenn ein Rentner mit seiner Rente über dem Grundfreibetrag liegt und insofern eine Steuererklärung abgeben muss.
Stimmt aber nicht: Jeder Rentner muss selbst in Erfahrung bringen, ob er steuerpflichtig ist oder nicht. Dazu beantragt er zunächst die "Mitteilung zur Vorlage beim Finanzamt" bei der deutschen Rentenversicherung. Diese Bescheinigung enthält alle steuerrechtlich relevanten Beträge mit Hinweisen, in welchen Zeilen der Steuervordrucke die entsprechenden Werte einzutragen sind, wenn der Rentner eine Steuererklärung abgeben muss. Damit das Finanzamt den steuerpflichtigen Anteil der gesetzlichen Rente korrekt ermitteln kann, müssen Rentner ihrer Steuererklärung die ausgefüllten Steuervordrucke "Anlage R" und "Anlage Vorsorgeaufwand" beifügen. Doch selbst wer eine Steuererklärung abgeben muss, hat nicht unbedingt auch Steuern zu zahlen: Auch Rentner dürfen Kosten absetzen, unter anderem 102 Euro als Werbungskostenpauschale, Handwerkerkosten oder Krankheitskosten.
Wer die Rentenbezugsmitteilung zum ersten Mal benötigt, kann sie per Brief, Fax, Telefon oder Internet anfordern und gibt, ganz wichtig, seine persönliche Rentenversicherungsnummer an. Wer die Mitteilung einmal beantragt hat, erhält sie in den Folgejahren automatisch zugesandt. Wer die Bescheinigung für eine Hinterbliebenenrente benötigt, gibt die Versicherungsnummer des Verstorbenen an. Wer es versäumt seine Steuererklärungspflicht rechtzeitig zu klären, dem drohen Verspätungszuschläge und Zwangsgelder. Im schlimmsten Fall kann das Finanzamt die Besteuerungsgrundlagen schätzen, was in der Regel zu Ungunsten des Steuerbürgers ausfällt.
Steuer-Irrtum 7: So eine Steuererklärung ist nichts als lästig
Amtliche Nachweise raussuchen, manche Dokumente vielleicht noch anfordern müssen, Belege entziffern, Formulare ausfüllen und das alles rechtzeitig: Die Steuererklärung machen ist für viele eine lästige Qual.
Aber wer sich Zeit nimmt, sich die Mühe macht und sich vielleicht sogar noch ein bisschen auskennt, der kann gutes Geld zurückbekommen: Durchschnittlich über 970 Euro erhielten Steuerzahler, die eine Steuererklärung fürs Steuerjahr 2014 eingereicht hatten, laut Statistischem Bundesamt zurück. Für Mitglieder der VLH sind es in Erstattungsfällen derzeit durchschnittlich mehr als 1.300 Euro.
Doppelte Haushaltsführung: BFH erlaubt über 1.000 Euro monatlich
Mehr als 1.000 Euro im Monat können Arbeitnehmer absetzen, die aus beruflichen Gründen eine Zweitwohnung mieten (doppelte Haushaltsführung). Das hat der Bundesfinanzhof (BFH) in seinem Urteil vom 4. April 2019 entschieden.
Viele hunderttausende Arbeitnehmer unterhalten eine Zweitwohnung - allein im Jahr 2014 waren es laut Statistischem Bundesamt fast 385.000 -, weil die Entfernung zwischen Arbeitsort und Hauptwohnsitz zu weit entfernt ist für die tägliche Fahrt.
Alte Regel: maximal 1.000 Euro monatlich absetzen
Den Betroffenen entstehen etliche Ausgaben, die doppelt gezahlt werden müssen wie Miete, Nebenkosten, Strom, Heizung, Möbel, die Rundfunkgebühren oder der Kfz-Stellplatz.
Diese und viele weitere Kosten für eine doppelte Haushaltsführung lassen sich von der Steuer absetzen. Seit 2014 galt eine monatliche Obergrenze von 1.000 Euro, doch Berufstätige mit einer Zweitwohnung in kostspieligen Wohnorten wie München, Frankfurt oder Düsseldorf liegen bereits mit der Monatsmiete häufig über der 1.000-Euro-Grenze.
Neue Regel: 1.000 Euro im Monat plus Hausrat und Einrichtung
Der BFH hat diese Obergrenze in seinem Urteil mit Aktenzeichen VI R 18/17 gekippt: Fielen die Ausgaben für notwendige Einrichtungsgegenstände wie Küche, Bett, Schrank, Tisch, Stühle, Kühlschrank, Duschvorhang oder Nachttisch bislang in die Maximalsumme von 1.000 Euro im Monat, sind künftig die tatsächlichen Kosten dieser Gegenstände zusätzlich absetzbar.
Dabei gilt: Einrichtungsgegenstände, die nicht mehr als 800 Euro (410 Euro bis 2018) netto kosten, können noch im Anschaffungsjahr steuerlich geltend gemacht werden. Einrichtungsgegenstände, die dagegen den Nettowert von 800 Euro (410 Euro bis 2018) übersteigen, sind über mehrere Jahre abzuschreiben.
Unsere Empfehlung als Vereinigte Lohnsteuerhilfe (VLH): Arbeitnehmer, die aus beruflichen Gründen eine Zweitwohnung unterhalten, sollten alle Rechnungen und Nachweise für notwendige Einrichtungsgegenstände sammeln und prüfen lassen, ob die Kosten eventuell bis zum Jahr 2014 rückwirkend geltend gemacht werden können.
Überblick: Diese Kosten für die doppelte Haushaltsführung sind absetzbar
· Miete
· Nebenkosten
· Kosten für die Reinigung von Keller oder Treppenhaus
· Kosten für die Müllabfuhr, den Schornsteinfeger oder die Straßenreinigung
· Rundfunkgebühren
· Kosten für einen Kfz-Stellplatz
· Zweitwohnungssteuern
· Maklerkosten
· Umzugskosten
· Renovierungsarbeiten
· Kosten für ein häusliches Arbeitszimmer
· Fahrtkosten für eine Fahrt nach Hause oder stattdessen ein 15-minütiges Telefongespräch einmal in der Woche
· Verpflegungsmehraufwand innerhalb der ersten drei Monate
· Anschaffung von Einrichtungsgegenständen und Hausrat
Therapiekosten bei Burnout können steuerlich absetzbar sein
Immer mehr Menschen fühlen sich erschöpft und ausgebrannt. Sie leiden unter einem Burnout. Häufig hängt dies mit einer großen Belastung im Job zusammen. Ein hohes Arbeitspensum und der damit verbundene Zeitdruck führen zu permanentem Stress und Schlafproblemen. Dazu kommen vielleicht noch Unzufriedenheit, Enttäuschung oder Mobbing. Sport und Entspannung am Feierabend und ein kurzer Urlaub reichen meist nicht aus. Nach dem Urlaub kommen die Symptome schnell zurück. Medizinische Behandlungen sind notwendig, um Heilung zu erreichen.
Burnout ist keine typische Berufskrankheit
Da die seelischen und körperlichen Probleme in erster Linie durch den Beruf verursacht werden, sollte man meinen, Burnout zähle zu den Berufskrankheiten. Fallen Kosten zur Verbesserung oder Heilung von Berufskrankheiten an, so sind diese als Werbungskosten in unbegrenzter Höhe bei der Einkommensteuer abziehbar. So waren beispielsweise die Behandlungen einer Schultergelenkserkrankung einer Berufsgeigerin in der Einkommensteuer abziehbar. Im Fall von Burnout sahen es die Richter vom Bundesfinanzhof jedoch anders.
Burnout wird nicht als eine typische Berufskrankheit, wie z. B. die Staublunge eines Bäckers, eingestuft. Da ein Burnout in seinen psychischen und psychosomatischen Ausprägungen vielfältig ist, wird er nicht hundertprozentig der emotionalen Belastung im Beruf zugeschrieben. Auch wenn das Arbeitsverhältnis Hauptauslöser dieser Erkrankung ist, kommt oftmals eine private Mehrfachbelastung dazu. Somit wurde einem generellen Werbungskostenabzug bei Burnout eine Absage erteilt. Hierfür ist die ausschließliche berufliche Ursache Voraussetzung.
Burnout durch Mobbing am Arbeitsplatz
Wird ein Mitarbeiter jedoch in der Firma gemobbt und erkrankt infolge dessen, sieht der Sachverhalt anders aus. "Beeinträchtigen Kollegen oder Vorgesetzte die Psyche oder Gesundheit eines Mitarbeiters, so dürfen die Behandlungskosten unter gewissen Voraussetzungen sehr wohl in der Einkommensteuer als Werbungskosten geltend gemacht werden", erklärt Robert Dottl, Vorstand der Lohnsteuerhilfe Bayern e.V. (Lohi).
Um das dem Finanzamt gegenüber zu belegen, sollte ein ärztliches Attest vorliegen, dass der Burnout auf Mobbing am Arbeitsplatz zurückzuführen ist. Ebenso ist es ratsam, die Notwendigkeit einer Therapie, um seinen Beruf weiter ausüben zu können, vor Antritt der Behandlungen durch einen Arzt bescheinigen zu lassen. Dann ist ein eindeutiger Zusammenhang zwischen der beruflichen Tätigkeit und der Burnout-Erkrankung gegeben und die selbst getragenen Behandlungskosten können in voller Höhe als Werbungskosten geltend gemacht werden.
Außergewöhnliche Belastungen als Plan B
Ist der Werbungskostenabzug nicht möglich, können die eigens finanzierten Kosten einer Therapie als außergewöhnliche Belastung angesetzt werden. Dies setzt aber ein vor der Therapie ausgestelltes amtsärztliches Attest oder eine Bescheinigung des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung über die Notwendigkeit der Behandlung voraus. "Großer Nachteil der außergewöhnlichen Belastung jedoch ist, dass die zumutbare Grenze der Eigenbelastung erst überschritten werden muss. Daher ist ein Werbungskostenabzug, wenn möglich, vorzuziehen", so Robert Dottl.
Sind Fahrtkosten zum getrennt lebenden Kind absetzbar?
Leben getrennte Eltern weit entfernt voneinander, können hohe Besuchskosten auf sie zukommen.
In jeder fünften Familie ist die Mutter oder der Vater alleinerziehend. Das macht in Deutschland rund 1,6 Mio. Haushalte aus, in denen Kinder von nur einem Elternteil betreut werden. Leben die Eltern eines Kindes getrennt und weiter voneinander entfernt, entstehen dem anderen Elternteil Fahrtkosten, um das Kind zu sehen und vorübergehend zu betreuen. Wer seinem regelmäßigen Umgangsrecht nachkommt, belastet mit zunehmender Entfernung seinen Geldbeutel.
Hierbei geht es nicht die üblichen Kosten für die Betreuung des Kindes, also Verpflegung und Freizeitaktivitäten, sondern um die zusätzlichen Fahrtkosten, um ein Kind zu sich nach Hause zu holen oder zu besuchen, die erst durch die räumliche Entfernung der beiden Elternwohnungen entstehen.
Mit der Entfernung steigen die Besuchskosten
Auch wenn die jährlichen Kosten wie im unten angeführten Fallbeispiel fünfstellig ausfallen, können diese durch die Trennung zwangsläufig entstandenen Ausgaben leider nicht im Rahmen der Einkommensteuererklärung geltend gemacht werden, erklärt die Lohnsteuerhilfe lohi.de. Der Bundesfinanzhof urteilte, dass solche Kosten nicht als außergewöhnliche Belastung abgesetzt werden können, da sie unter die typischen Aufwendungen der Lebensführung fallen, auch wenn sie in Einzelfällen hoch sind und die individuelle Grenze der zumutbaren Belastung überschreiten.
Fallbeispiel: Mutter und Vater wohnen 350 km voneinander entfernt:
Die Mutter, bei der die beiden Töchter leben, wohnt in Regensburg, der Vater der beiden Mädchen wohnt und arbeitet mittlerweile in Dresden. Jedes zweite Wochenende verbringen die beiden Mädchen bei ihrem Vater. Dafür holt der Vater seine Kinder am Freitagabend mit dem Auto ab und bringt sie nach Dresden. Am Sonntagabend fährt er sie wieder zurück zur Mutter. Die Wegstrecke beträgt einfach 350 km. Für den Vater bedeutet das, dass er alle zwei Wochen 1.400 km zu fahren hat. Wenn man die üblichen 30 Cent pro Kilometer für den Wertverlust des Pkw und die Benzinkosten ansetzt, so wären das 420 Euro je Wochenende und hochgerechnet auf ein Jahr um die 10.000 Euro. Ein schönes Sümmchen, das rein für die Besuchsfahrten draufgeht.
Wären die beiden Mädchen im Beispiel alt genug, um alleine mit dem Zug von Regensburg nach Dresden zu fahren, so müsste der Vater in der Regel die Kosten für die Bahntickets übernehmen, die ebenfalls im oberen vierstelligen Bereich für beide liegen würden. Das Umgangsrecht des Vaters ist also in jedem Fall mit enormen Kosten verbunden, damit er und seine Kinder Zeit miteinander verbringen können. Aber leider hat der Gesetzgeber hier keinen steuerlichen Abzug vorgesehen.
Steuerabzug bei kranken oder behinderten Kindern möglich
Für außergewöhnliche Belastungen sind laut Gesetzgeber nicht nur die Höhe, sondern insbesondere die Art und der Entstehungsgrund, die außerhalb des Üblichen liegen müssen, entscheidend. Daher gibt es Ausnahmeregelungen, die den steuerlichen Abzug von Aufwendungen für den Besuch des Kindes rechtfertigen, nur im Falle von kranken oder behinderten Kindern. Aber auch dann müssen die Besuche über die normale elterliche Besuchspflicht hinausgehen und der Pflege oder Heilung des Kindes dienen, so die Lohnsteuerhilfe lohi.de.
Kapitalerträge: Ist mit der Abgeltungsteuer wirklich alles erledigt?
Wann Sie die Anlage KAP ausfüllen sollten oder es sogar müssen
Ist mit der Abgeltungssteuer nicht schon alles abgegolten? Nicht unbedingt. Dafür gibt es bei der Einkommensteuerklärung die Anlage KAP. Wann Sie ausfüllen sollten oder es sogar müssen, erklärt Ecovis-Steuerberater Thomas Schnellhammer aus Passau.
Wann Sie Kapitalerträge angeben sollten
Ist mit der Abgeltungsteuer wirklich alles erledigt? „Nicht immer“, sagt Ecovis-Steuerberater Thomas Schnellhammer. Seiner Meinung nach lässt sich mit dem Ausfüllen der Anlage KAP Steuern sparen. Zum Beispiel wenn der Sparerfreibetrag noch nicht vollständig ausgenutzt ist. Ledige haben einen Sparerfreibetrag von 801 Euro; bis zu diesem Betrag sind Kapitalerträge steuerfrei. Bei Verheirateten liegt er bei 1.602 Euro. „Sind die Freistellungsaufträge bei unterschiedlichen Banken falsch verteilt, dann lohnt sich das Ausfüllen der Anlage KAP“, berichtet Schnellhammer aus seiner Erfahrung als Steuerberater. Wer seine Freistellungsaufträge bei unterschiedlichen Banken grundsätzlich richtig verteilt, kann sich diese Arbeit sparen.
Der zweite Fall, bei dem sich das Ausfüllen der Anlage KAP lohnt: Wenn der persönliche Einkommensteuersatz unter 25 Prozent liegt. „Arbeitet jemand nicht mehr Vollzeit, sondern Teilzeit, verringert sich sein Einkommen. Es kann schnell passieren, dass dann der Grenzsteuersatz fällt“, so Schnellhammer. Liegt er unter 25 Prozent, lohnt es sich, wenn der Steuerpflichtige die Kapitalerträge detailliert angibt. Versteuert er die Kapitalerträge, die über dem Freibetrag liegen, mit seinem niedrigeren Steuersatz spart er somit Steuern.
Wann Sie Kapitalerträge angeben müssen
In einigen Fällen müssen Steuerpflichtige sogar die Anlage KAP ausfüllen und ihre Einnahmen in der Steuererklärung angeben. Zum Beispiel für Angehörigendarlehen oder Darlehen gegenüber der eigenen Gesellschaft, für die keine Kapitalertragsteuer einbehalten wurde. „Wer meint, dass er vor dem Finanzamt seine Einnahmen verheimlichen kann, damit sie steuerfrei bleiben, irrt. Spätestens, wenn der Darlehensnehmer die Zinsen in seiner Steuererklärung als Aufwand angibt, weiß das Finanzamt Bescheid“, warnt Thomas Schnellhammer. Und das ist Steuerhinterziehung.
Wie lange es die Kapitalertragsteuer überhaupt noch in der heutigen Form gibt, steht in den Sternen. Denn heute tauschen Kreditinstitute und Finanzbehörden bereits im großen Stil auch grenzüberschreitend Daten aus. „Für den Gesetzgeber gibt es daher eigentlich keinen Grund mehr, mit der günstigen Kapitalertragsteuer von 25 Prozent der Steuervermeidung entgegenzuwirken“, sagt Ecovis-Steuerexperte Schnellhammer. Ecovis wird Sie darüber auf dem Laufenden halten.
Sportverletzung: Diese Kosten können Sie absetzen
Yoga im Park, Joggen mit dem Hund, auf dem Mountainbike durch den Wald: Endlich wird es Frühling und es zieht viele raus in die Natur, denn Sport hält in der Regel fit und gesund. Aber was tun, wenn man einen Sportunfall erleidet? Und aufgrund langwieriger Verletzungen viel Zeit und Geld in die Heilung investieren muss? Welche Kosten Sie bei Sportverletzungen von der Steuer absetzen können, erklärt der Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe e.V. (VLH).
Mit etwas Pech kann ein rutschiger Weg, eine unerwartete Stolperfalle oder einfach nur übertriebener Ehrgeiz für begeisterte Outdoor-Sportler zu komplizierten Brüchen oder Muskelrissen führen. Bei solchen und ähnlichen langwierigen Verletzungen stehen für Sie als Patient regelmäßige Arztbesuche, Physiotherapien, Kuraufenthalte oder sogar Reha-Maßnahmen an. Die Ausgaben dafür übernimmt oft die gesetzliche Krankenversicherung - doch alles, was diese nicht übernimmt, können Sie als Krankheitskosten beziehungsweise außergewöhnliche Belastung von der Steuer absetzen.
Alternative Behandlungsmaßnahmen absetzen
Das gilt auch für Behandlungsmaßnahmen, die wissenschaftlich nicht anerkannt sind, wie die Bioresonanz- oder Eigenbluttherapie: Werden die Kosten dafür nicht von der Krankenkasse übernommen, lassen sich die Ausgaben von der Steuer absetzen.
Wichtig ist, dass ein amtsärztliches Attest oder eine Bescheinigung des Medizinischen Dienstes der Krankenkassen die Notwendigkeit dieser Behandlung nachweist; und dass dieses Attest vor Beginn der Behandlung ausgestellt wurde. Neu seit ist, dass ein solches Attest nicht mehr einem sehr ausführlichen, detaillierten Bericht entsprechen muss; stattdessen reicht eine kurze Stellungnahme des Amtsarztes oder Medizinischen Dienstes aus.
Medikamente absetzen
Von der Steuer absetzbar sind außerdem Medikamente, die selbst bezahlt wurden - allerdings nur, wenn Ihnen dafür ein ärztliches Rezept vorliegt. Wer sich ohne Rezept mit Medikamenten versorgt, kann die Kosten dafür nicht von der Steuer absetzen.
Fahrtkosten absetzen
Auch Fahrtkosten zu Ärzten, Physiotherapeuten oder Heilpraktikern, sogar zur Apotheke und zum Sanitätshaus sind als Krankheitskosten absetzbar: Wer mit Taxi, Bus oder Bahn unterwegs ist, sollte die entsprechenden Tickets und Quittungen sammeln; fahren Sie als Patient mit dem Auto, ermitteln Sie die angefallene Wegstrecke und rechnen 30 Cent pro Kilometer.
So drücken Senioren ihre Steuerlast
Die seit 2005 geltende Rentenbesteuerung führt dazu, dass Jahr für Jahr mehr Rentner von einer Besteuerung betroffen sind. Denn mit jedem späteren Renteneintrittsjahr steigt der zu versteuernde Rentenanteil und der damit verbundene Freibetrag sinkt. Künftige Rentnerjahrgänge müssen bereits mit geringeren Bezügen Steuern zahlen, als dies bei früheren Jahrgängen der Fall war. Wer im Jahr 2019 in Rente geht, muss 78 Prozent seiner Rente versteuern. Es bleiben also nur noch 22 Prozent der Jahresrente steuerfrei.
Die jährlichen Anpassungen der Rente an das Lohnniveau sind ebenfalls in voller Höhe steuerpflichtig. 2019 rutschen durch die Rentenerhöhung 48.000 Rentner in die Steuerpflicht, die bisher befreit waren. Ein Viertel aller Rentner, knapp fünf Millionen Senioren, müssen 2019 ihre Steuererklärung abgeben. Dies beschert dem Bundesfinanzministerium 410 Millionen Euro zusätzlich. Wer in der Rente Steuern zahlen muss, kann die Steuerlast mindern. Hans Daumoser, Vorstand der Lohi (Lohnsteuerhilfe Bayern e. V.), stellt nachfolgend die sieben effektivsten Steuertipps für Rentner vor.
Sonderausgaben
"Zunächst dürfen laut Gesetz die Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung als Sonderausgaben abgesetzt werden", so der Steuerexperte der Lohi. "Das sind immerhin schon rund elf Prozent der Rente." Auch Beiträge zur Haftpflicht-, Unfall- oder Zahnzusatzversicherung kommen in Frage, wenn die steuerliche Höchstgrenze noch nicht erreicht wurde. Nicht zu vergessen sind die sonstigen Sonderausgaben, wie ein Versorgungsausgleich, Unterhaltsleistungen, die Kirchensteuer, Parteibeiträge oder Spenden. In den meisten Fällen wird der Pauschbetrag von 36 Euro (72 Euro bei gemeinsamer Veranlagung) überschritten.
Haushaltsnahe Dienstleistungen
Werden haushaltsnahe Dienstleistungen in Anspruch genommen, so können die Kosten dafür zu 20 Prozent abgesetzt werden. Darunterfallen nicht nur die Kosten für eine Putzhilfe oder ambulante Pflege, sondern auch der Hausnotruf. Wer krankheitsbedingt in einem Pflegeheim wohnen muss, kann alle Dienstleistungen im Heim, auch für den Haarschnitt oder die Fußpflege, als haushaltsnahe Dienstleistung geltend machen. Mieter finden häufig auch Posten in der Nebenkostenabrechnung des Vermieters, die absetzbar sind. Ähnlich zu den haushaltsnahen Dienstleistungen lassen sich auch Handwerkerrechnungen in der Rente von der Steuer absetzen.
Außergewöhnliche Belastungen
Alle Ausgaben, die unter die außergewöhnlichen Belastungen fallen, sollten für die Steuererklärung addiert werden. Dies sind z. B. die Kosten für die Brille, das Hörgerät, den Zahnersatz oder den Rollator. Auch nicht verschreibungspflichtige Medikamente auf Rezept, Zuzahlungen bei der Physiotherapie, Honorare für Heilpraktiker oder vom Arzt verordnete medizinische Behandlungen, die die Krankenkasse nicht übernommen hat, können in der Steuererklärung angegeben werden. Wissenschaftlich nicht anerkannte Behandlungen müssen zuvor vom Amtsarzt attestiert werden.
Fahrtkosten zum Arzt, zur Physiotherapie oder ins Krankenhaus können mit 30 Cent pro Kilometer berücksichtigt werden. Viele einzelne kleinere Rechnungen können hier am Ende ins Gewicht fallen. Und große Investitionen wie in einen Treppenlift, im Zuge eines alters- oder behindertengerechten Umbaus des Eigenheims, machen sich richtig bemerkbar. Es kommt zwar die zumutbare Belastung zum Tragen, bevor etwas abgesetzt werden kann, aber die ist bei kleineren Renten nicht wirklich hoch.
Behindertenpauschbetrag
Bei permanenten chronischen Leiden oder dauerhaften gesundheitlichen Einschränkungen sollte darüber nachgedacht werden, ob nicht ein Behinderungsgrad festgestellt werden kann. Wird ein Grad der Behinderung von 25 bis 100 bescheinigt, so kann nach dem Grad gestaffelt der Behinderten-Pauschbetrag zwischen 310 und 1.420 Euro und erhöht bis 3.700 Euro geltend gemacht werden.
Liegt der Behinderungsgrad bei 70 mit dem Merkmal "G" oder bei 80, so kann zusätzlich eine Pauschale für Fahrtkosten in Höhe von 900 Euro als außergewöhnliche Belastung beansprucht werden. Bei den Merkmalen "aG", "BI" oder "H" können für Privatfahrten von bis zu 15.000 km und sogar bis zu 4.500 Euro abgesetzt werden, wenn die tatsächliche Fahrleistung nachgewiesen oder glaubhaft gemacht werden kann.
Werbungskosten
Jedem steuerpflichtigen Rentner wird vom Finanzamt automatisch eine Pauschale von 102 Euro angerechnet. Oft liegen aber höhere Werbungskosten, z. B. aufgrund einer gebührenpflichtigen Rentenberatung, Steuerberatung, Mitgliedschaft bei einem Lohnsteuerhilfeverein, Kontoführungsgebühren, Gewerkschafts- oder Verbandsbeiträgen vor. Auch Rechtsberatungs- oder Prozesskosten, bei denen es um die Rente geht, sind anzuführen. Wird einem Nebenjob, der kein Minijob ist, nachgegangen, so kommen die Fahrtkosten, Arbeitsmittel und Fortbildungskosten dazu.
Günstigerprüfung für Kapitalerträge
"Liegt der persönliche Steuersatz in der Rente unter 25 Prozent und fallen aufgrund von lebenslangen Ersparnissen Kapitalerträge an, so sollte auf der Anlage KAP die "Günstigerprüfung" angekreuzt werden", rät Hans Daumoser. Denn dann wird die Differenz zwischen dem niedrigeren persönlichen Steuersatz und der abgeführten Abgeltungsteuer rückerstattet.
Wer steuerpflichtig ist, sollte seine Steuererklärung von sich aus fristgerecht abgeben und darauf achten, dass er möglichst viel absetzen kann. Damit das Finanzamt die Abzüge anerkennt, müssen aber das ganze Jahr über Belege gesammelt werden. Denn nur nachweisliche Ausgaben werden steuerlich berücksichtigt. Wer jedoch unter dem steuerfreien Existenzminimum lebt, kann sich von der Abgabepflicht zur Steuererklärung befreien lassen und ist damit ein für alle Mal den Papierkram los.
Arbeitnehmer können vereinfachte Steuerformulare nutzen
Steuerzahlerbund erklärt, wer davon profitiert
Viele Arbeitnehmer wissen nicht, dass sie mit einer vereinfachten Steuererklärung viel Zeit sparen können. Der Vorteil: Das zweiseitige Formular beschränkt sich nur auf die notwendigsten Angaben. Wer eine vereinfachte Erklärung abgeben darf und wer bei den ausführlichen Vordrucken bleiben muss, erklärt der Bund der Steuerzahler.
Die Steuererklärung ist so gestaltet, dass alle erdenklichen Einkommensarten und Umstände des Steuerzahlers abgefragt werden. Für den durchschnittlichen Arbeitnehmer, der lediglich Arbeitslohn in Deutschland und gegebenenfalls Lohnersatzleistungen (z. B. Elterngeld, Mutterschaftsgeld, Arbeitslosengeld) bezieht, ist das meiste davon nicht relevant. Dem durchschnittlichen Arbeitnehmer soll die vereinfachte Einkommensteuererklärung Erleichterung verschaffen. Neben dem Namen, der Anschrift und den Kontodaten müssen Sie lediglich Ihre Steuer-Identifikationsnummer, die Sie auf der Lohnsteuerbescheinigung finden, eintragen. Die Daten aus der Lohnsteuerbescheinigung holt sich das Finanzamt dann automatisch.
Allerdings kommt die reduzierte Erklärung nur dann in Betracht, wenn Sie keine weiteren als die im Formular bezeichneten Werbungskosten, Sonderausgaben, außergewöhnlichen Belastungen und Steuerermäßigungen geltend machen wollen. Die Entfernungspauschale für Ihren Arbeitsweg können Sie im Formular angeben. Sollten Sie aber weitere Werbungskosten geltend machen wollen, zum Beispiel ein häusliches Arbeitszimmer, doppelte Haushaltsführung oder Mehraufwendungen für Verpflegung, müssen Sie bei den ausführlichen Formularen bleiben.
Beachten sollten Sie auch, dass der zweiseitige Vordruck allein möglicherweise nicht ausreicht. Etwaige Anlagen müssen Sie trotzdem beilegen. Zu den Zusatzunterlagen, die Sie der reduzierten Erklärung beilegen dürfen, gehört die Anlage Kind, die Anlage Vorsorgeaufwand sowie die Anlage AV für Beiträge zur Riester-Rente. Sollten Sie darüber hinaus weitere Anlagen als die genannten benötigen, beispielsweise, weil Sie noch andere Einkünfte bezogen haben, dann können Sie die „Vereinfachte Einkommensteuererklärung für Arbeitnehmer“ nicht nutzen. Für Rentner, Selbstständige sowie Arbeitnehmer mit zusätzlichen Einkünften aus Vermietung und Verpachtung kommt die reduzierte Variante der Steuererklärung somit nicht in Betracht, erklärt der Bund der Steuerzahler. Ehegatten und Lebenspartner können sie außerdem dann nicht verwenden, wenn sie sich getrennt veranlagen lassen. In diesen Fällen müssen Sie die ausführlichen Vordrucke zur Einkommensteuererklärung einreichen.
Diese sechs Tipps können helfen Ihre Steuerberatungskosten zu senken
1) Vorab prüfen, ob überhaupt ein zugelassener Steuerberater nötig ist.
Für Privatpersonen, die nicht selbstständig erwerbstätig sind bieten Lohnsteuerhilfevereine ihre Leistungen oftmals viel kostengünstiger an als klassische Steuerberater. Sofern Sie lediglich Einkünfte aus einem Angestelltenverhältnis erhalten und keiner selbstständigen Erwerbstätigkeit als Unternehmer oder Freiberufler nachgehen, können Sie auch Unterstützung durch einen Lohnsteuerhilfeverein anfordern. Diese sind ebenfalls dazu ermächtigt, Steuerberatung zu leisten und für Sie Ihre Steuererklärung anzufertigen. Die Kosten hierfür werden durch einen Mitgliedsbeitrag abgegolten, der aber je nach Einkommen gestaffelt sein kann. Sofern Sie keine komplexeren Steuerfragen haben, müssen Sie hierfür in der Regel weniger bezahlen als für einen Steuerberater.
2) Anfragen und Vergleichen.
Der einfachste Weg den günstigsten Steuerberater zu finden, besteht darin, mehrere Steuerberater anzuschreiben oder anzurufen und nach Preisvorstellungen zu fragen.
Seien Sie dabei möglichst konkret Ihr Anliegen genau zu beschreiben, um eine ehrliche Einschätzung der Kosten zu erfragen. Ansonsten können Sie im Nachhinein mit einer höheren Rechnung überrascht werden, weil der Arbeitsaufwand für den Steuerberater seine ersten Einschätzungen deutlich überstiegen hat.
3) Nutzen Sie Erfahrungsberichte und Bewertungen.
Aber Vorsicht: Das Kontaktieren vieler möglicher Steuerbüros wird einige Zeit in Anspruch nehmen. Dieses Vorgehen hat aber den Vorteil, dass der Kostenvoranschlag für die Steuerberatung auf Ihr Problem zugeschnitten ist. Wenn Sie bei der Suche im Internet Erfahrungsberichte und Kostenvergleiche anderer Klienten finden, besteht immer die Gefahr, dass deren Anliegen sich von Ihrem Auftrag deutlich unterscheiden und für jene ein anderer Steuerberater günstiger war als für Sie.
4) Die Lage des Steuerbüros beachten.
Es kann sein, dass Steuerbüros in Vororten günstiger sind als solche in exklusiven Großstadtlagen, da sich ein geringerer Mietpreis auch in niedrigeren Fixkosten für den Steuerberater widerspiegelt. Ob eine kleinere Steuerkanzlei auch mit niedrigeren Kosten für den Klienten verbunden ist, lässt sich hingegen nicht pauschal beantworten: zwar kann aufgrund der niedrigeren Fixkosten für Personal und Miete auch mit niedrigeren Honoraren wirtschaftlich gearbeitet werden, doch lassen sich in größeren Büros viele Abläufe effizienter implementieren.
5) Versuchen Sie Pauschalpreise für administrative Tätigkeiten zu verhandeln.
Haben Sie besonders viele Rechnungen benötigen eine regelmäßige Buchhaltung, dann können Sie diese Tätigkeiten auch ihrem Steuerbüro übertragen. Hier können Sie durch fair vereinbarte Festpreise und die Aussicht auf eine langfristige Partnerschaft auch Kosten sparen.
6) Helfen Sie mit!
Je gründlicher Sie alle potentiell notwendigen Belege und Unterlagen vorab sammeln und sortieren und dem Steuerbüro zur Verfügung stellen können, umso weniger zeit- und kostenintensiver Aufwand verbleibt beim Steuerberater.
Wie ermitteln sich die Kosten und Honorare eines Steuerberaters grundsätzlich?
Die zulässigen Honorare für die Steuerberatung werden zwar in einer Vergütungsverordnung festgelegt doch der Spielraum für die Steuerberater-Vergütung ist sehr groß: in den meisten Fällen liegt der Maximalbetrag beim vier- bis zehnfachen des Minimalhonorars. Dieser Ermessensspielraum soll dem Steuerberater die Möglichkeit geben, den tatsächlich anfallenden Arbeitsaufwand angemessen zu berücksichtigen. Die meisten Steuerberater orientieren sich dabei am sogenannten Mittelwert, dem arithmetischen Mittel zwischen dem niedrigsten und dem höchsten zulässigen Honorar.
Versuchen Sie also, aus der Vergütungsverordnung selbst den Mittelwert des Preises für Ihre Beratung zu berechnen, und vergleichen Sie dann die Kostenvoranschläge der verschiedenen Steuerbüros mit diesem Mittelwert. Liegen die genannten Preisvorstellungen deutlich oberhalb des abgeschätzten Mittelwerts, ist das Steuerbüro eher teuer; wird Ihnen hingegen ein niedrigerer Preis genannt, haben Sie einen günstigen Steuerberater gefunden, raten die Experten von Steuerberater-Wegweiser.de.
Vorsorgeaufwendungen – an das Alter denken und Steuern sparen
Alter oder Krankheit stellen unabwendbare Lebensrisiken dar, die jeden treffen können. Versicherungen sollen dazu dienen, diese Risiken abzufedern. Dass eine Vorsorge nicht nur für den Einzelnen, sondern auch für die Gesellschaft als Ganzes sinnvoll ist, zeigt sich daran, dass Versicherungsbeiträge zumindest teilweise steuerlich absetzbar sind. „Diese Versicherungsbeiträge gehören als sogenannte Vorsorgeaufwendungen zu den Sonderausgaben, die im Rahmen der Anlage ‘Vorsorgeaufwand‘ bei der Einkommensteuererklärung geltend gemacht werden können“, so die Steuerberaterkammer Nürnberg.
Altersvorsorgeaufwendungen
Seit 2005 gilt für gesetzliche Rentenversicherungsbeiträge und Altersrenten grundsätzlich eine nachgelagerte Besteuerung. Das heißt, dass die Rentenversicherungsbeiträge steuerlich abzugsfähig sind und im Gegenzug die Renteneinkünfte versteuert werden müssen. Bis 2025 gilt noch eine Übergangsregelung, nach der der steuerlich absetzbare Teil der Rentenversicherungsbeiträge jährlich um zwei Prozent steigt. 2019 liegt er bei 88 Prozent der Gesamtversicherungsbeiträge (Arbeitgeber- und Arbeitnehmeranteil). Dieser Übergangszeitraum endet 2025, wenn 100 Prozent erreicht werden. Abgesehen davon existiert auch noch eine absolute Obergrenze für den abzugsfähigen Betrag. Diese Grenze liegt 2019 bei 24.305 Euro. Für Ehepaare gilt der doppelte Betrag von 48.610 Euro.
Private Altersvorsorge
Wer über die gesetzliche Rente hinaus für das Alter vorsorgen will, dem stehen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung. Im Rahmen der Riester-Rente zahlt der Staat z. B. Zulagen, wenn ein bestimmter Eigenbeitrag erbracht und in einen Altersvorsorgevertrag eingezahlt wird. Außerdem besteht die Möglichkeit, die Aufwendungen einschließlich der Zulagen bis zu einer Höhe von 2.100 Euro im Jahr als Sonderausgaben abzuziehen. Dafür verwendet der Steuerpflichtige die Anlage AV zur Einkommensteuererklärung.
Kranken- und Pflegeversicherung
Für gesetzlich Krankenversicherte sind sämtliche gezahlten Beiträge für die sogenannte Basisabsicherung steuerlich abzugsfähig. Keine Berücksichtigung hingegen findet der Beitragsanteil, der etwa der Finanzierung von Krankengeld dient. Dieser bleibt pauschal durch einen Abschlag von vier Prozent steuerlich unberücksichtigt.
Bei privat Krankenversicherten erkennt das Finanzamt nicht alle Aufwendungen an, da häufig der Leistungskatalog über das gesetzlich als notwendig Erachtete hinausgeht. So bleiben beispielsweise Beitragsbestandteile für die Chefarzt-Behandlung oder das Einzelzimmer steuerlich unberücksichtigt. Privat Versicherte müssen deshalb darauf achten, dass ihre Krankenkasse gemäß den Regeln der Krankenversicherungsbeitragsanteil-Ermittlungsverordnung (KVBEVO) die nichtsteuerbegünstigten getrennt von den steuerbegünstigten Leistungen ausweist.
Sonstige Vorsorgeaufwendungen
Zu den sonstigen Vorsorgeaufwendungen gehören z. B. Beiträge zur Arbeitslosen-, Erwerbs- und Berufsunfähigkeitsversicherung, zu Unfall- sowie Haftpflichtversicherungen oder auch Beiträge zu Kranken- und Pflegeversicherungen außerhalb der Basisabsicherung. Solche Aufwendungen sind nur beschränkt im Rahmen der aktuellen Höchstbeträge von 1.900 Euro (z. B. für Angestellte, Beamte und Rentner) bzw. 2.800 Euro (z. B. für Selbstständige) absetzbar. Dies gilt nur, soweit dieser Höchstbetrag nicht bereits durch die oben genannten Beiträge zu Basiskranken- und Pflegeversicherungen ausgeschöpft ist. Bei Ehegatten wird für jeden getrennt der zutreffende Betrag festgestellt und anschließend werden beide Beträge zusammengezählt.
Erstattungen durch eine Krankenkasse
Noch nicht für alle Fälle abschließend geklärt ist die Frage, wie mit Erstattungen durch eine Krankenkasse umzugehen ist. Der Bundesfinanzhof (BFH) hat bereits 2016 entschieden, dass eine Bonuszahlung der Krankenkasse an den Steuerpflichtigen nur dann als Beitragsrückerstattung angesehen werden kann, wenn sie im unmittelbaren Zusammenhang mit den Beiträgen zur Erlangung des Basiskrankenversicherungsschutzes steht. Ist dies der Fall, ist die Erstattung mit den Krankenversicherungsbeiträgen zu verrechnen. So mindert sie den entsprechenden Sonderausgabenabzug. Für eine pauschale Erstattung im Rahmen eines Bonusprogramms für vom Versicherten getragene Kosten für besondere Vorsorge- und Gesundheitsmaßnahmen hat das Sächsische Finanzgericht im
September 2018 entschieden, dies sei eine Leistung der Krankenkasse und keine Beitragsrückerstattung. Die Erstattung wäre daher nicht mit den als Sonderausgaben abziehbaren Krankenversicherungsbeiträgen des Steuerpflichtigen zu verrechnen. Da die Finanzverwaltung dies anders sieht, wird sich der BFH mit dieser Frage noch befassen,so die Steuerberaterkammer Nürnberg.
Den Lebensabend im Ausland verbringen: Das sollten Rentner wissen
Den wohlverdienten Ruhestand im Ausland verbringen und von mehr Sonnenstunden und günstigeren Preisen profitieren - ein Traum vieler Deutscher. Für deutsche Staatsangehörige wurden 2017 laut der Deutschen Rentenversicherung 238.117 Renten ins Ausland gezahlt. Doch wer seine Rente im Ausland bezieht, muss bei Steuern und Versicherungen einiges beachten. Der gemeinnützige Verbraucher-Ratgeber Finanztip hat deshalb die wichtigsten Tipps zusammengestellt.
Wer länger als sechs Monate im Jahr im Ausland lebt, gilt als beschränkt steuerpflichtig und hat dann kein Recht auf den Grundfreibetrag: "Das steuerpflichtige Einkommen und daher auch die Rente, werden ab dem ersten Euro versteuert", erklärt Udo Reuß, Steuerexperte bei Finanztip. Auch zahlreiche weitere Vergünstigungen entfallen: "Ehegattensplitting, außergewöhnliche Belastungen wie Krankheitskosten und Freibeträge für Kinder werden nicht mehr angerechnet. Das treibt die Steuerlast stark in die Höhe."
Mit einem Antrag auf unbeschränkte Steuerpflicht die Steuerlast senken
Doch wer mindestens 90 Prozent seines Gesamteinkommens aus Deutschland bezieht und dieses auch hier versteuern muss, für den kann es einen Trick geben: "Stellen Sie beim Finanzamt einen Antrag auf unbeschränkte Steuerpflicht", empfiehlt Reuß. Bei einem Umzug etwa nach Österreich, Spanien oder Polen wird die gesetzliche Rente grundsätzlich in Deutschland besteuert. Hier kann sich der Antrag auf unbeschränkte Steuerpflicht lohnen. Reuß erklärt: "Legen Sie dafür einen Nachweis ausländischer Einkünfte von den Behörden im Ausland bei. Für den Umzug in einen EU-Staat benötigen Sie zum Beispiel die Bescheinigung EU/EWR, die es in verschiedenen Sprachversionen gibt."
Ob die Rente in Deutschland oder im neuen Wohnland zu versteuern ist, legt das jeweilige Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) fest. Eine Übersicht aller Länder, mit denen ein DBA besteht, gibt es auf der Website des Bundesfinanzministeriums.
Die Behörde rechtzeitig informieren
Um Renten auszuzahlen, benötigt die Deutsche Rentenversicherung lediglich Adresse, Kontaktdaten und die Bankverbindung. "Teilen Sie der Behörde und der Krankenkasse den Wechsel des Wohnortes mindestens drei Monate im Voraus mit", rät Reuß. "Verlangt die Behörde eine Lebensbescheinigung, senden Sie diese schnellstmöglich ausgefüllt zurück, sonst kann es zu Unterbrechungen der Rentenzahlungen kommen!"
Vor dem Auslandsaufenthalt sollten Rentner sich beraten lassen
Das Finanzamt Neubrandenburg ist zuständig für Rentenempfänger im Ausland. Auf deren Website finden Verbraucher die erwähnten Formulare und zahlreiche Informationen. Doch Reuß rät davon ab, sich allein auf die Online-Informationen zu verlassen: "Wie fast immer im Steuerrecht sind die Fälle sehr individuell. Vor dem geplanten Aufenthalt rate ich daher jedem, die Beratungsstelle der Deutschen Rentenversicherung aufzusuchen oder sich mit dem Rentenversicherungsträger in Verbindung zu setzen." Bestehen weitere steuerpflichtige Einkünfte, wie etwa Einnahmen durch Vermietung, ist das Heimat-Finanzamt zuständig.
Gut zu wissen: Wer seinen Wohnsitz dauerhaft ins Ausland verlegt, ist in der Regel nicht über die gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherung der Rentner versichert. Rentner sollten sich vor dem Auslandsaufenthalt daher unbedingt bei der Deutschen Verbindungsstelle Krankenversicherung - Ausland beraten lassen. Wer außerhalb des Europäischen Währungsraums lebt, muss die staatliche Förderung der Riester-Rente zurückzahlen.
Fehlerhafter Steuerbescheid – Einspruchsfrist beachten
Wer kennt es nicht: Da flattert der Einkommensteuerbescheid ins Haus, doch die berechnete Steuer weicht von der Vorhersage des eigenen Steuerprogramms ab. Schaut man genauer hin, stellt man häufig fest, dass Fahrtkosten, Krankenkassenbeiträge oder andere steuermindernde Ausgaben nicht vollständig anerkannt wurden. In der heutigen Zeit läuft vieles digital ab. „Daten von Kranken- und Rentenversicherungen werden elektronisch übermittelt und ungeprüft übernommen. Da kommt es schnell zu Fehlern, bei denen sich die Einlegung eines Einspruchs lohnt.“, so die Steuerberaterkammer Stuttgart.
Die Monatsfrist
Jeder Einspruch kann nur Erfolg haben, wenn der Steuerpflichtige diesen rechtzeitig einlegt. Die Frist hierzu beträgt einen Monat. Wird die Frist jedoch versäumt, weist das Finanzamt jeden noch so gut begründeten Einspruch als unzulässig zurück. Die Frist beginnt mit Ablauf des Tages, an dem der Steuerbescheid dem Steuerpflichtigen zugestellt wurde. Lässt sich der genaue Tag des Posteinwurfs nicht beweisen, nimmt die Finanzverwaltung an, dass der Bescheid binnen drei Tagen nach dem Versand beim Steuerzahler angekommen ist. Wird der Steuerbescheid mit Einwilligung des Steuerzahlers im Elster-Portal zur Abholung bereitgestellt, gilt der Bescheid in der Regel drei Tage nach Absendung der Mail-Benachrichtigung über die Bereitstellung als bekannt gegeben. Die Monatsfrist endet im Folgemonat mit Ablauf des Tages, der nach seiner Zahl dem Tag der Zustellung im Vormonat entspricht. Fällt dieser Tag auf einen Samstag, Sonn- oder Feiertag, so endet die Frist erst mit Ablauf des darauf folgenden Werktages. Ist die Zustellung am 31. eines Monats erfolgt, endet die Frist bereits am 30. des Folgemonats, wenn dieser nur 30 Tage hat.
Beispiele:
1. Der Steuerbescheid wird am Montag, dem 16. April 2018, zugestellt. Die Monatsfrist endet am Mittwoch, dem 16. Mai 2018.
2. Der Steuerbescheid wird am Freitag, dem 27. April 2018, zugestellt. Der 27. Mai 2018 ist ein Sonntag. Demzufolge läuft die Monatsfrist am Montag, dem 28. Mai 2018, um 24:00 Uhr ab.
3. Der Steuerbescheid wird am Mittwoch, dem 31. Oktober 2018, zugestellt. Die Monatsfrist endet am Freitag, dem 30. November 2018, da der November nur 30 Tage hat.
Was muss der Einspruch zur Einhaltung der Monatsfrist beinhalten?
Für die Fristwahrung reicht es zunächst einmal aus, den Steuerbescheid genau zu bezeichnen und zu schreiben, dass dagegen Einspruch eingelegt werde.
Das Einspruchsschreiben muss den Absender und dessen eigenhändige Unterschrift enthalten. Sonst ist der Einspruch unwirksam.
Der Steuerpflichtige braucht den Einspruch nicht bereits innerhalb der Einspruchsfrist zu begründen. Die Begründung kann zu einem späteren Zeitpunkt nachgereicht werden. Im Zweifel kann man den Einspruch zur Wahrung der Frist ohne Begründung einlegen. Dann hat man nachfolgend Zeit, sich durch einen Steuerberater kundig zu machen.
Was kommt nach dem Einspruch?
Ergibt sich aus dem Steuerbescheid eine offene Steuerschuld, muss diese in aller Regel trotz Einspruch an das Finanzamt erstmal gezahlt werden. Der Einspruch hat im Normalfall keine aufschiebende Wirkung. Nach Erhalt eines rechtzeitig eingelegten Einspruchs kann das Finanzamt eine weitere Frist setzen, etwa um den Einspruch näher zu begründen, offene Punkte zu klären oder Unterlagen vorzulegen.
Nach Einlegung und Begründung des Einspruchs muss das Finanzamt die Sache in vollem Umfang erneut prüfen und darüber entscheiden. Denkbar ist leider auch eine ungünstige Erhöhung der Steuer, beispielsweise wenn Werbungskosten oder sonstige Vergünstigungen aberkannt werden. Man spricht dabei von einer Verböserung des ursprünglichen Steuerbescheids. In solchen Fällen muss das Finanzamt Gelegenheit zur Stellungnahme geben. Der Steuerzahler hat dann die Möglichkeit, den Einspruch zurück zu nehmen und es bei der ursprünglich berechneten Steuer zu belassen.
Einsprüche – ein positives Fazit
Fast zwei Drittel der eingelegten Einsprüche haben Erfolg, so die Statistik des Bundesfinanzministeriums vom 19. Oktober 2017. Mit der Expertise eines Steuerberaters sind die Chancen gut, im Einspruchsverfahren ein optimales Ergebnis zu erzielen. Der bundesweite Steuerberater-Suchdienst (www.stbk-stuttgart.de) bietet die Möglichkeit, einen oder mehrere seinen Anforderungen entsprechende Steuerberater nach den Kriterien Ort (bzw. Postleitzahl), Arbeitsgebiete, Branchenkenntnisse und/oder Fremdsprachenkenntnisse in ganz Deutschland zu suchen.
Während der Uni Steuern sparen? Was Studierende beachten sollten
Im Studium ist das Geld oft knapp. Gleichzeitig müssen angehende Akademiker für Semesterbeiträge oder Fachbücher meist tief in die Tasche greifen. Dabei können sie mit einer freiwilligen Steuererklärung viele Kosten noch im Nachhinein von der Steuer absetzen. Denn der Fiskus unterstützt Studierende finanziell stärker als gemeinhin angenommen. „Auch für angehende Akademiker zahlt es sich aus, Belege von Studienausgaben fortlaufend aufzubewahren und gut zu sortieren. So geht keine Quittung verloren und Studierende können bares Geld sparen“, so die Steuerberaterkammer Stuttgart.
Warum sollten Studenten eine Steuererklärung abgeben?
Auch Studierende können Studienkosten bei einer Steuererklärung geltend machen, selbst wenn sie noch keine Einkommensteuer während ihres Studiums zahlen, sondern z. B. finanziell von ihren Eltern unterstützt werden oder in einem Minijob arbeiten. Sie können einen Verlustvortrag auf Folgejahre angeben. Dieser gilt bei sogenannten Werbungskosten, die im Rahmen eines Zweitstudiums bzw. einer Zweitausbildung entstehen. Die Kosten können in den Folgejahren die Einkommensteuer senken, wenn der Studierende bereits im Job steht und Einkünfte erzielt. Da Studenten auch ohne eigene Einnahmen während des Studiums immer Aufwendungen haben dürften, sollten sie die Abgabe einer Steuererklärung auf jeden Fall erwägen.
Was können Studenten von der Steuer absetzen?
Wenn Akademiker ein Zweitstudium beginnen, können sie jegliche studienbezogenen Kosten, wie den Semesterbeitrag, Laptop, Fahrtkosten für Exkursionen, Kopien oder Studienbücher, als Werbungskosten geltend machen. Als Zweitstudium gilt beispielsweise ein Masterstudiengang oder ein Studium nach einer Ausbildung. Die Miete für ihre WG-Zimmer oder Wohnungen können sie hingegen nur bei doppelter Haushaltsführung steuerlich geltend machen.
Aufwendungen für die erste Berufsausbildung oder für ein Erststudium, wie einen Bachelorstudiengang, können als sogenannte Sonderausgaben bis zu maximal 6.000 Euro im Kalenderjahr von der Steuer abgezogen werden. Ein Sonderausgabenabzug ist nur von den eigenen Einkünften des Steuerpflichtigen im gleichen Jahr möglich. Der Bundesfinanzhof hat aber die Versagung des Abzugs als Werbungskosten und damit die Versagung der Entstehung eines Verlustvortrages bei einer Erstausbildung für verfassungswidrig erklärt und diese Regelung dem Bundesverfassungsgericht zur Entscheidung vorgelegt. Die Beschränkung steht somit momentan auf dem Prüfstand. Aller Voraussicht nach fällt das Bundesverfassungsgericht noch in diesem Jahr eine Entscheidung. Daher kann es sich für angehende Akademiker lohnen, die Kosten einer Erstausbildung/eines Erststudiums als Werbungskosten in der Steuererklärung anzugeben und dann das Verfahren offen zu halten, um die günstigere Möglichkeit des späteren Verlustabzugs doch noch wahrzunehmen.
Welche Formulare müssen Studenten bei der Steuererklärung ausfüllen?
Für eine Steuererklärung muss auf jeden Fall ein sogenannter Mantelbogen, der die persönlichen Daten der Steuerpflichtigen, die Steuernummer, die Adresse des Finanzamts und die Steueridentifikationsnummer umfasst, abgegeben werden. Außerdem sind je nach Einkunftsart die entsprechenden Anlagen beizufügen, also z. B. Anlage N für Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit. Hier sind auch die vorweggenommenen Werbungskosten anzugeben. Die Finanzämter gehen im Rahmen der elektronischen Einreichung der Steuererklärung zunehmend dazu über, keine sofortige Einreichung der Belege zur Einkommensteuererklärung zu fordern. Jedoch sollten Studierende die Belege, etwa für Fachbücher und weitere Studienkosten, gut aufbewahren, da sie diese auf Nachfrage gegebenenfalls doch dem Finanzamt vorlegen müssen.
Fazit
Auch für Studenten kann sich die Abgabe einer Steuererklärung finanziell lohnen. Um keine Sparmöglichkeiten zu verpassen, empfiehlt es sich, entsprechende Belege zu sammeln und sorgfältig abzuheften. Um die Vorteile einer Steuererklärung rechtlich sicher nutzen zu können, ist der Rat eines Experten empfehlenswert. Der bundesweite Steuerberater-Suchdienst (www.stbk-stuttgart.de) bietet die Möglichkeit, einen oder mehrere seinen Anforderungen entsprechende Steuerberater nach den Kriterien Ort (bzw. Postleitzahl), Arbeitsgebiete, Branchenkenntnisse und/oder Fremdsprachenkenntnisse in ganz Deutschland zu suchen.
Weiterbildungskosten mit dem Fiskus teilen
Weiterbildungen stehen bei Arbeitnehmern hoch im Kurs und werden für die berufliche Karriere immer wichtiger. Ob Sprachkurse, Kurse zur Erlangung von IT-Kenntnissen oder Kurse zur Weiterentwicklung spezieller beruflicher Fähigkeiten: Das Feld für Fortbildungen ist groß. Dient diese Weiterbildung der Sicherung und Erhaltung der Einnahmen aus nichtselbstständiger Arbeit, beteiligt sich der Fiskus an den Kosten. „Denn dann handelt es sich steuerlich um sogenannte Werbungskosten, die die Einkommensteuerlast mindern“, erklärt die Steuerberaterkammer Stuttgart.
Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein?
Sprachkurse und andere Fortbildungen führen nur bei einer beruflichen Veranlassung zu berücksichtigungsfähigen Werbungskosten. Fehlt die Berufsbezogenheit, so handelt es sich um nicht abziehbare Aufwendungen der Allgemeinbildung. Diese werden als Kosten der Lebensführung steuerlich nicht berücksichtigt. Des Weiteren muss der Arbeitnehmer die Berufsbezogenheit nachweisen. Am einfachsten ist es, wenn der Arbeitgeber bescheinigt, dass die Weiterbildung beruflichen Erfordernissen dient, etwa weil der Arbeitnehmer zukünftig ins Ausland versetzt wird und daher einen Sprachkurs absolviert.
Welche Kosten sind als Werbungskosten abziehbar?
Typische Weiterbildungskosten sind die Kursgebühren, die notwendigen Fahrtkosten, Übernachtungskosten und weitere Kosten, z. B. für Fachbücher.
Kompliziert wird es insbesondere, wenn der (Sprach-)Kurs im Ausland stattfindet und eine private Mitveranlassung nicht ausgeschlossen werden kann. Hier entstehen im Regelfall zusätzliche Aufwendungen, etwa für die Anreise und Übernachtung. Dabei wird im Rahmen einer Gesamtwürdigung geprüft, ob nicht hinsichtlich der Ortswahl eine private Mitveranlassung vorliegt und die Kosten daher aufzuteilen sind. Bei dieser Abwägung sind in eine Gesamtwürdigung die folgenden Umstände einzubeziehen: Veranstaltungsort (typisches Feriengebiet?), Jahreszeit und Gestaltung der unterrichtsfreien Tage. Der Steuerpflichtige muss zudem seine Teilnahme am Unterricht nachweisen. Beim Kursort gilt dabei der Grundsatz: Je exotischer, desto privater, zum Beispiel wenn ein Spanischkurs in Südamerika absolviert wird.
Liegt eine private Mitveranlassung eines (Sprach-)Kurses vor, werden die nicht direkt zuordenbaren Kosten ggf. aufgeteilt. Ein sachgerechter, den Verhältnissen im Einzelfall entsprechender Aufteilungsmaßstab kann dabei grundsätzlich das Verhältnis der beruflichen und privaten Zeitanteile der Reise sein. Ist dieses nicht möglich, so kann eine hälftige Aufteilung bzw. ein hälftiger Werbungskostenabzug sämtlicher mit dem Sprachkurs verbundener Reisekosten entsprechend der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofes in Betracht kommen. Wie die umfangreiche Rechtsprechung zeigt, kommt es hier häufig zum Streit mit der Finanzverwaltung.
Kann der Arbeitgeber die Fortbildungskosten steuerfrei an seinen Arbeitnehmer erstatten?
Findet die Weiterbildung im betrieblichen Interesse des Arbeitgebers statt, weil sie bspw. die Einsatzfähigkeit des Arbeitnehmers im Betrieb des Arbeitgebers erhöht, kann der Arbeitgeber die Kosten dieser Fortbildung ohne steuerliche Folgen übernehmen. Dies gilt auch für den Fall, dass der Arbeitnehmer die Fortbildungsveranstaltung in seiner Freizeit besucht, z. B. samstags. Ein steuerpflichtiger Arbeitslohn liegt in der Übernahme der Fortbildungskosten durch den Arbeitgeber dann nicht vor. Auch sprachliche Fortbildungen dienen dem betrieblichen Interesse des Arbeitgebers, wenn der Arbeitgeber die Sprachkenntnisse in dem für den Arbeitnehmer vorgesehenen Aufgabengebiet verlangt.
Fazit
Wie die obigen Ausführungen zeigen, können sich Aufwendungen für die Weiterbildung sowohl für den Arbeitnehmer als auch für den Arbeitgeber auszahlen. Auf jeden Fall sollte vor dem Beginn der Weiterbildungsmaßnahme Rat durch einen Steuerberater eingeholt werden.
Mieten, kaufen, wohnen – vom Fiskus unterstützt
Trautes Heim, Glück allein – ein eigenes Haus oder eine eigene Wohnung ist der Traum vieler Deutscher. Ob für eigene Wohnzwecke oder zur Vermietung, Immobilien sind derzeit gefragt wie noch nie und dementsprechend teuer. „Damit der Traum vom Eigenheim durch die entstehenden Kosten aber nicht zum Alptraum wird, kann der Steuerpflichtige die Aufwendungen unter bestimmen Bedingungen steuerlich geltend machen. Hier kommt es zum einen auf die Art der Nutzung und zum anderen auf die Art der Aufwendungen an.“, so die Steuerberaterkammer Stuttgart.
Selbstnutzung oder Vermietung?
Hat der Steuerpflichtige eine Immobilie gekauft bzw. gebaut und möchte diese selbst nutzen, handelt es sich um eine private Einkommensverwendung. In diesem Fall kann er grundsätzlich keine Anschaffungs- oder Herstellungskosten steuermindernd geltend machen. Für Handwerkerleistungen wie Reparaturen oder Erhaltungsaufwendungen, z. B. beim Austausch von Fenstern, besteht aber die Möglichkeit, die Kosten als haushaltsnahe Dienstleistungen von der Steuer abzusetzen. Für die Arbeitskosten kann der Steuerpflichtige 20 Prozent der Aufwendungen, höchstens aber 1.200 Euro im Jahr, von der Einkommensteuerschuld abziehen.
Beabsichtigt der Steuerpflichtige, die gekaufte bzw. neu gebaute Immobilie dauerhaft zu vermieten, besteht dagegen eine sogenannte Einkunftserzielungsabsicht. In diesem Fall kann er sowohl die Anschaffungskosten als auch die laufenden Kosten steuerlich geltend machen. Wer eine Wohnung an Angehörige vermietet, sollte beachten, dass die Nutzungsüberlassung in einen entgeltlichen und einen unentgeltlichen Teil aufzuteilen ist, wenn die Miete weniger als 66 Prozent der ortsüblichen Vergleichsmiete beträgt. Bei beispielsweise 60 Prozent der ortsüblichen Miethöhe sind auch nur 60 Prozent der mit der Wohnung in Verbindung stehenden Kosten bei der Steuer absetzbar. Liegt die Miete bei 66 Prozent der ortsüblichen Vergleichsmiete oder mehr, sind die anfallenden Kosten vollständig absetzbar. Als ortsübliche Miete für Wohnungen vergleichbarer Art, Lage und Ausstattung ist die durchschnittliche Kaltmiete zuzüglich der nach der Betriebskostenverordnung umlagefähigen Kosten definiert. Maßgebend ist hierfür der örtliche Mietspiegel.
Anschaffungs- und Herstellungskosten
Zu den Anschaffungskosten zählen grundsätzlich alle Aufwendungen, die beim Erwerb eines bebauten Grundstücks anfallen. Dazu gehören auch die Nebenkosten der Anschaffung, wie etwa die Grunderwerbsteuer, Grundbuchkosten, Notariatsgebühren oder Maklerkosten. Diese Aufwendungen kann der Steuerpflichtige über einen typisierten Nutzungszeitraum abschreiben. Wenn absehbar ist, dass die tatsächliche Nutzung des Gebäudes geringer als die für die Bemessung der Abschreibungen typisiert angenommenen 40 oder 50 Jahre ist, kann der Steuerpflichtige die Kosten entsprechend der tatsächlichen Nutzungsdauer absetzen. Dies gilt auch für Herstellungskosten, also Aufwendungen, um eine Immobilie zu bauen, zu erweitern oder diese über den ursprünglichen Zustand hinausgehend wesentlich zu verbessern. Wird bei einem bereits bestehenden Haus durch einen Anbau oder durch einen Dachausbau neuer Wohnraum geschaffen, liegen ebenfalls Herstellungskosten vor. Je nach Bauzeitpunkt gelten hier andere Abschreibungssätze als bei Anschaffungskosten.
Anschaffungsnahe Herstellungskosten
Bei den anschaffungsnahen Herstellungskosten gibt es ein paar Besonderheiten zu beachten: Wenn der Steuerpflichtige Instandsetzungs- und Modernisierungsarbeiten oder auch Schönheitsreparaturen innerhalb von drei Jahren nach der Anschaffung eines Gebäudes durchführt, werden die Kosten steuerlich als Herstellungskosten behandelt, wenn sie ohne Umsatzsteuer 15 Prozent der Anschaffungskosten des Gebäudes übersteigen. Bleiben die Aufwendungen unter diesen 15 Prozent, kann der Steuerpflichtige diese als Werbungskosten sofort abziehen. Aber Achtung: Summieren sich die Kosten im Laufe der drei Jahre und übersteigen diese den Prozentsatz, ändert sich auch rückwirkend die steuerliche Behandlung der Kosten.
Laufende Kosten sind Werbungskosten
Der Steuerpflichtige kann die laufenden Kosten bei vermieteten Objekten in der Regel in dem Jahr, in dem sie anfallen, als Werbungskosten steuerlich geltend machen. Dazu gehören z. B. Erhaltungsaufwendungen für Schönheitsreparaturen wie Maler- und Tapeziererarbeiten. Die Werbungskosten umfassen außerdem Finanzierungskosten und Schuldzinsen, Grundsteuer, Betriebskosten und einiges mehr.
Kreditzinsen kann der Steuerpflichtige in voller Höhe als Werbungskosten geltend machen, wenn der Kredit für den Kauf der Immobilie aufgenommen und auch ausschließlich dafür verwendet wird. Verwendet er den Kredit nur teilweise für die Anschaffung eines Hauses und zum Teil für andere private Zwecke, kann er die Zinsen nur anteilig als Werbungskosten abziehen. Muss ein Haus verkauft werden, bevor der Kredit abbezahlt ist, und reicht der Veräußerungserlös nicht aus, um den Kredit zu tilgen, kann der Steuerpflichtige die Zinsen auch weiterhin als nachträgliche Werbungskosten aus Vermietung und Verpachtung geltend machen, bis der Kredit abbezahlt ist.
Fazit
Diese Beispiele zeigen, dass es für Immobilienbesitzer und solche, die es werden wollen, steuerlich viel zu beachten gibt. Um Fallstricke zu umgehen, empfiehlt es sich, den Rat eines Steuerberaters in Anspruch zu nehmen.
Der Bund fürs Leben – vom Fiskus unterstützt
In guten und in schlechten Zeiten für den Partner einstehen – das honoriert der Fiskus, indem er Ehepaare und eingetragene Lebenspartnerschaften mit der gemeinsamen Besteuerung ihrer Einkommen, der Zusammenveranlagung bzw. dem sogenannten Ehegattensplitting, entlastet. Grundsätzlich gilt der Splittingtarif für Ehegatten und eingetragene Lebenspartnerschaften, die beide unbeschränkt einkommensteuerpflichtig sind und nicht dauernd getrennt leben. In solchen Fällen dürfen die Partner wählen, welche Art der steuerlichen Veranlagung sie bevorzugen. Sie können zwischen der Einzel- und der Zusammenveranlagung wählen. „Ein Ehepaar sollte in jedem Falle abwägen, welche Variante unter welchen Umständen steuerlich von Vorteil ist. Dabei gibt es aber einiges zu beachten.“, so die Steuerberaterkammer Stuttgart.
Was ist das Ehegattensplitting und wer kann es nutzen?
Beim sogenannten Ehegattensplitting bzw. bei der Zusammenveranlagung behandelt der Fiskus das Ehepaar gemeinsam als Steuerpflichtigen und berechnet die Steuer folgendermaßen: Die Summe beider Einkommen wird zunächst durch zwei geteilt, um die Steuer für die Hälfte des Einkommens zu ermitteln. Anschließend verdoppelt die Finanzverwaltung diesen Betrag, um die fälligen Steuern festzulegen.
Beispiel:
Partner A hat ein Einkommen von 50.000 Euro im Jahr 2017 und Partner B eines von 30.000 Euro. Zusammen verfügen sie über 80.000 Euro. Das hälftige Einkommen beträgt 40.000 Euro und wird als Besteuerungsbasis herangezogen. Für dieses Einkommen ergibt sich ein Steuerbetrag von 8.766 Euro. Nach der Verdopplung ergibt sich eine Gesamtsteuer von 17.532 Euro.
Am 26. April 2017 hat der Bundesfinanzhof (BFH) entschieden, dass Partner einer nicht-ehelichen Lebensgemeinschaft die Zusammenveranlagung nicht wählen können. Der BFH ist der Ansicht, dass nur Ehen oder Lebenspartnerschaften nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz einer rechtlichen Bindung entsprechen, die eine Zusammenveranlagung rechtfertigt. Auch Alleinerziehende sind von den Vergünstigungen des Splittingtarifs ausgeschlossen. Der BFH sieht diesen Ausschluss als verfassungsgemäß an, allerdings liegt hierzu bereits eine Verfassungsbeschwerde vor dem Bundesverfassungsgericht (Az. 2 BvR 221/17) vor.
Was ist eine Einzelveranlagung?
In ihrer Steuererklärung steht für Ehepaare und eingetragene Lebenspartnerschaften die sogenannte Einzelveranlagung zur Wahl. Hier unterliegen die Partner dem normalen Grundtarif. Nach dem obigen Beispiel würden für Partner A 12.561 Euro (50.000 Euro Einkommen) und für Partner B 5.419 Euro (30.000 Euro Einkommen) Gesamtsteuern fällig. Bei der Einzelveranlagung zahlen beide Partner zusammen 448 Euro mehr an Steuern. Machen die Ehepartner hierzu keine Angaben, geht die Finanzverwaltung davon aus, dass sie die Zusammenveranlagung bevorzugen.
Welche Veranlagungsart ist von Vorteil?
In der Regel erweist sich die Zusammenveranlagung als vorteilhafter gegenüber der Einzelveranlagung. Durch das Splittingverfahren kann das Paar die Steuerbelastung senken. Der Vorteil ist umso größer, je weiter die beiden Einkommen auseinanderliegen. Außerdem können die Ehepartner Freibeträge doppelt nutzen sowie Sonderausgaben und außergewöhnliche Belastungen des Ehegatten, dem weniger Einkommen zur Verfügung steht, geltend machen. Die gewählte Veranlagungsart gilt für ein Steuerjahr.
Um Ehepartnern oder Lebenspartnerschaften die Steuerklassenwahl zu erleichtern, stellt das BMF jährlich aktualisierte Tabellen zur Steuerklassenwahlkombination zur Verfügung. Diese sind auf der Website des Bundesfinanzministeriums unter www.bundesfinanzministerium.de zu finden. Die Tabellen ermöglichen ein Ablesen der Steuerklassenkombination, welche beim derzeitigen Einkommen die geringste Lohnsteuer entstehen lässt.
Fazit
Trotz dieser Hilfestellung der Finanzverwaltung empfiehlt es sich im Einzelfall die Vorteile der Veranlagungsarten zu prüfen und für die Wahl einer optimalen Lösung einen Steuerberater hinzuzuziehen.
Steuerbelastung ist in Deutschland relativ gleichmäßig über die Einkommensgruppen verteilt
Geringverdienende sind relativ stark mit indirekten Steuern belastet
Die prozentuale Belastung mit Steuern und Sozialbeiträgen in Deutschland ist erstaunlich gleichmäßig über alle Einkommensgruppen verteilt und wirkt nur wenig progressiv. Dies zeigt eine aktuelle Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin). „Lediglich die Einkommen- und Unternehmenssteuern sind stark progressiv und belasten vorwiegend Haushalte mit höheren Einkommen“, sagt DIW-Steuerexperte Stefan Bach. „Knapp die Hälfte des Steueraufkommens entfällt aber auf indirekte Steuern wie Mehrwertsteuer, Energiesteuern oder Genussmittelsteuern, die Haushalte mit niedrigen Einkommen deutlich stärker belasten als Haushalte mit hohen Einkommen.“ Berücksichtige man auch die Sozialbeiträge, so falle die gesamte relative Belastung der mittleren Einkommen nicht viel geringer als die der sehr hohen Einkommen aus.
Geordnet nach der Höhe des Bruttoeinkommens, tragen die obersten zehn Prozent der Einkommensverteilung 42 Prozent des gesamten Steueraufkommens beziehungsweise 33 Prozent des gesamten Steuer- und Sozialbeitragsaufkommens, das oberste eine Prozent trägt 16 beziehungsweise zehn Prozent. Die untersten zehn Prozent tragen gut zwei Prozent des gesamten Steueraufkommens beziehungsweise knapp zwei Prozent des gesamten Steuer- und Sozialbeitragsaufkommens, so die Studie.
Steuerklasse optimieren - wer rechtzeitig handelt, kann beim Elterngeld profitieren
Die Steuerberaterkammer Stuttgart informiert: Grundsätzlich können verheiratete Arbeitnehmer und eingetragene Lebenspartner ihre Steuerklasse frei wählen. So bestimmen sie mit, wie viel Lohnsteuer der Arbeitgeber jeden Monat an das Finanzamt abführt. Zur Wahl stehen derzeit drei Kombinationen und als Faustregel gilt: Die Kombination IV / IV ist erste Wahl, wenn beide Partner etwa gleich viel verdienen. Die Kombination III / V bringt mehr Netto im Monat, wenn der Gehaltsunterschied zwischen den Ehepartnern hoch ist. Dabei wird das höhere Einkommen mit der Klasse III relativ niedrig, das geringe Einkommen mit der Klasse V relativ hoch besteuert. Und die Kombination IV Faktor / IV Faktor, das sog. Faktorverfahren, soll einen gerechteren Ausgleich zwischen Verdienst und Lohnsteuerabzug bei Paaren mit einem größeren Gehaltsunterschied sicherstellen.
Ein Steuerklassenwechsel ist prinzipiell nur einmal im Jahr möglich und spätestens bis zum 30. November des laufenden Jahres beim zuständigen Finanzamt einzureichen. Beruhigend zu wissen: Selbst wenn nicht die günstigste Steuerklassenkombination gewählt wurde, zahlen die Betroffenen letztlich insgesamt nicht mehr Steuern. Abgerechnet wird mit der jährlichen Einkommensteuererklärung und da spielen die Steuerklassen für die Höhe der festzusetzenden Steuersumme keine Rolle. Eine falsche Wahl kann sich hier insofern auswirken, als entweder zu wenig oder zu viel Steuern im Jahresverlauf entrichtet wurden, wofür eine Nachzahlung fällig wird oder erfreulicherweise eine Erstattung vom Finanzamt erfolgt.
Elterngeld und Steuerklasse
Die Wahl der Steuerklasse hat aber sehr konkrete Auswirkungen auf die Höhe von Lohnersatzleistungen, zu denen auch das Elterngeld gehört, denn sie kann bares Geld bedeuten. Eine günstige Steuerklasse in diesem Zusammenhang ist eine, die mehr Netto vom Brutto übrig lässt, also die Bewertungsbasis für das zu zahlende Elterngeld positiv beeinflusst. Aber Achtung: Der Steuerklassenwechsel vor der Geburt ist vom Gesetzgeber erschwert worden. Seit 2013 spielt der Zeitpunkt des Wechsels eine entscheidende Rolle, denn die Berechnung der Höhe des Elterngeldes erfolgt auf Basis der Steuerklasse, die mindestens sieben Monate vor der Geburt eingetragen war. Nach erkannter Schwangerschaft sollte also schnell gehandelt werden, um die für die Betroffenen beste Berechnungsbasis sicherzustellen. Wobei außer der 7-Monatsfrist auch noch daran zu denken ist, dass ein beantragter Steuerklassenwechsel erst ab dem Folgemonat gültig ist. Für die Änderung der Steuerklassen gibt es einen amtlichen Vordruck, der von beiden Ehe- bzw. Lebenspartnern unterschrieben an das Finanzamt geschickt werden muss.
Sonstige Auswirkungen eines Steuerklassenwechsels
Bei allen möglichen Vorteilen sollte jedoch auch bedacht werden, dass sich bei einem Wechsel der Steuerklassen auch die steuerlichen Koordinaten des Partners verschieben. Wechselt beispielsweise die Ehefrau von Steuerklasse V zu Steuerklasse III, so wechselt der Ehepartner zwangsläufig in die Steuerklasse V. Dann hat der Ehepartner, also in der Regel der Ehemann, einen geringeren Nettoverdienst, somit auch eine geringere Bewertungsbasis für Lohnersatzleistungen. Dies kann sich negativ auswirken auf den evtl. Bezug von Arbeitslosen- oder Kurzarbeitergeld, von Krankengeld oder dergleichen. Und weiterhin ist zu berücksichtigen, dass das Elterngeld zwar steuerfrei gezahlt wird, aber dem Progressionsvorbehalt unterliegt, d.h. zum Einkommen hinzugerechnet wird, wenn der individuelle Steuersatz vom Finanzamt nach Abgabe der Steuererklärung festgelegt wird.
Höhe des Elterngelds
Für die Berechnung des Elterngeldes ist grundsätzlich seit 2013 das pauschal ermittelte durchschnittliche Bruttoeinkommen aus Erwerbstätigkeit vor der Geburt des Kindes relevant, und zwar maßgeblich die letzten zwölf Kalendermonate. Klingt einfach, aber wirft in der Praxis immer wieder Fragen auf, z.B. im Zusammenhang mit Provisionen. Ohne hier ins Detail gehen zu können, bleibt festzuhalten, dass diese gemäß aktueller Entscheidungen des Bundessozialgerichtes unter bestimmten Voraussetzungen bei der Elterngeldberechnung zu berücksichtigen sind. Anders verhält es sich u.U. mit Zahlungen, die nicht regelmäßig im Jahresverlauf erfolgen. Aber unabhängig von diesen speziellen Fällen liegt das Elterngeld zwischen 100 % und 65 % der positiven Einkünfte sowohl aus selbstständiger als auch aus nichtselbstständiger Erwerbstätigkeit, gekürzt um Abzüge für Steuern und Sozialabgaben. Das Elterngeld beträgt höchstens 1.800 Euro und mindestens 300 Euro. Wobei der letztere Betrag prinzipiell auch denjenigen zusteht, die zuvor keine eigenen Einkünfte hatten. Bei Mehrlingsgeburten erhöht sich der jeweilige Betrag um 300 Euro je weiterem Kind. In bestimmten Fällen sieht das Gesetz auch einen Geschwisterbonus vor. Dieser erhöht das Elterngeld um 10 %, mindestens jedoch um 75 Euro.
Fazit
Auf jeden Fall sollte vor einem Steuerklassenwechsel eine sorgfältige Überprüfung der persönlichen Situation erfolgen, am besten mit Hilfe von Steuerexperten, damit vermeintliche Vorteile sich nicht ins Gegenteil verkehren. Der bundesweite Steuerberater-Suchdienst bietet die Möglichkeit, einen oder mehrere seinen Anforderungen entsprechende Steuerberater nach den Kriterien Ort (bzw. Postleitzahl), Arbeitsgebiete (z.B. Einkommensteuer), Branchenkenntnisse und/oder Fremdsprachenkenntnisse in ganz Deutschland zu suchen.
Sieben teure Fehler in der Steuererklärung
Handwerker-Rechnungen bar zahlen, Riester-Rente nicht angeben, Werbungskosten falsch eintragen, außergewöhnliche Belastungen außen vor lassen: Immer wieder verlieren Steuerzahler Geld durch Fehler in ihrer Einkommensteuererklärung. Ein Überblick.
Steuerfehler Nummer 1: Ausgaben vergessen
Beiträge zum Beispiel für die Riester- oder Rürup-Rente können Arbeitnehmer von der Steuer absetzen. Weil genau das beim Abschluss dieser Verträge meist als Verkaufsargument genannt wird, ist es vielen Bürgern bekannt - aber nicht bewusst. Aus der Praxis wissen wir, dass Steuerzahler oft vergessen, ihre Riester- und Rürup-Kosten in der Steuererklärung anzugeben.
Steuerfehler Nummer 2: Rechnungen bar zahlen
Handwerker, Putzfrauen oder auch Au-pairs haben gemeinsam, dass man die Kosten in vielen Fällen von der Steuer absetzen kann - entweder als sogenannte Handwerkerleistung oder als haushaltsnahe Dienstleistung. Eine weitere Gemeinsamkeit ist, dass Steuerzahler voll auf den Kosten sitzen bleiben, wenn sie das Geld bar bezahlen. Da hilft es auch nichts, die Rechnungen aufzuheben. Ohne Kontonachweis keine Steuervorteile.
Steuerfehler Nummer 3: Hintertür zuschlagen und außergewöhnliche Belastungen nicht angeben
Dieses Jahr erwarten Steuerexperten ein wichtiges Urteil des obersten Finanzgerichts, dem Bundesfinanzhof (BFH). Der BFH wird in Bezug auf außergewöhnliche Belastungen entscheiden, ob die Regel zur zumutbaren Eigenbelastung fällt. Bislang gilt: Nur die Krankheits-, Pflegeheim- oder Scheidungskosten, die über der eigenen zumutbaren Belastungsgrenze liegen, kann man absetzen. Wie hoch die Grenze für jeden Einzelnen ausfällt, richtet sich momentan vor allem nach dem Einkommen: Je mehr Sie verdienen, desto mehr Ausgaben gelten derzeit als zumutbar. Viele Bürger sammeln deshalb gar nicht erst die Belege für das Zahnimplantat oder die Brille, weil sie denken, dass sie mit den Kosten sowieso nicht über die Zumutbarkeitsgrenze kommen. Der Clou: Weil das Verfahren beim BFH läuft, können Sie schon jetzt jeden Cent Ihrer außergewöhnlichen Belastungen in der Steuererklärung angeben. Werden die BFH-Richter die Belastungsgrenze tatsächlich kippen, haben Sie sich damit größere Steuervorteile gesichert. Denn dann können Sie die vollen Kosten für das Zahnimplantat oder die Brille absetzen. Das gilt auch, wenn bis zu Ihrem Steuerbescheid kein Urteil gesprochen wird. Sie erhalten den vollen Steuervorteil bezüglich Ihrer außergewöhnlichen Belastungen dann nachträglich.
Steuerfehler Nummer 4: Mietvertrag mit Angehörigen nicht wasserdicht gestalten
Vermietungen unter Verwandten sind nicht ungewöhnlich. Der Mieter bekommt eine Immobilie zum günstigen Preis, der Vermieter kann - trotz geringerer Miete - seine Kosten für das Objekt voll absetzen. Das geht aber nur, wenn zwei Bedingungen erfüllt sind: Erstens, die monatliche Miete beträgt mindestens 66 Prozent der ortsüblichen Miete. Das heißt so viel wie: Zu günstig geht nicht. Zweitens hält die Durchführung des Mietvertrags einem Fremdvergleich stand. Das bedeutet: Die Miete wird überwiesen und nicht bar ausgezahlt, sie wird außerdem pünktlich überwiesen, es gibt eine jährliche Nebenkostenabrechnung und ähnliches mehr.
Steuerfehler Nummer 5: Einträge vertauschen
Sie haben eine Fortbildung selbst bezahlt, die Kosten dafür aber nicht bei Weiterbildung sondern bei allgemeinen Werbungskosten in der Steuererklärung angegeben? Oder Sie haben Handwerkerleistungen bei den außergewöhnlichen Belastungen eingetragen? So etwas passiert Laien immer wieder. Das Finanzamt streicht dann zwar die geltend gemachten Kosten aus den falschen Zeilen raus, trägt sie aber nicht in die richtigen ein. Die Rückzahlung, die Ihnen zustehen würde, bleibt einfach aus.
Steuerfehler Nummer 6: Fristen verstreichen lassen
Das Finanzamt schickt Ihnen den Steuerbescheid und Sie sind froh, dass Sie keine Steuern nachzahlen müssen? Oder Sie bekommen eine Rückzahlung, die aber geringer ausfällt als von Ihnen erwartet? Die meisten unternehmen in solchen Fällen nichts. Das könnte allerdings ein teurer Fehler sein. Denn vier Wochen nach dem Bescheid verstreicht die Einspruchsfrist. So lange können Sie den Bescheid genauer unter die Lupe nehmen oder einen Profi engagieren, der nachträglich für Sie gegenüber dem Finanzamt eintritt und etwaige Fehler behebt.
Steuerfehler Nummer 7: Steuererklärung nicht machen
Eine Steuererklärung lohnt sich und wer keine macht, verschenkt sein Geld. Das Statistische Bundesamt hat die Verluste ausgerechnet. Demnach bekommen Menschen durchschnittlich mehr als 400 Euro zurück, die ihre Steuererklärung selbst machen. Wer zum Steuerberater geht, erhält durchschnittlich ca. 800 Euro zurück. Und Mitglieder der VLH konnten sich im letzten Jahr durchschnittlich über 1.117 Euro Rückerstattung freuen.
Arbeitnehmer und Rentner müssen ihre Steuererklärung bis 31. Mai abgeben. Wer einen Steuerprofi - Steuerberater oder Lohnsteuerhilfeverein - beauftragt, hat mehr Zeit. Dann kann die Steuererklärung bis zum Jahresende abgegeben werden.
Aufbewahrungspflicht: Akten rechtzeitig vernichten
Alle Jahre wieder zum Jahresanfang stellt sich in den Unternehmen und bei Freiberuflern von neuem die Frage nach den Aufbewahrungspflichten: Welche Geschäftsdokumente müssen weiter aufbewahrt, welche können mit Beginn des neuen Jahres vernichtet werden? Einer aktuellen Studie von Blitzarchiv zufolge gehen 76 Prozent der mittelständischen Firmen davon aus, dass eine Vielzahl von Betrieben in Deutschland ihre Dokumente unnötig lange aufheben. Dies liegt daran, dass die Unternehmen sich unsicher sind, wie lange die gesetzlichen Aufbewahrungspflichten sind und darüber hinaus gar nicht wissen, wie lange bestimmte Unterlagen schon im eigenen Archiv lagern.
Grundsätzlich gilt, dass Unterlagen in der Regel entweder sechs oder zehn Jahre aufbewahrt werden müssen. Akten, die beispielsweise in 2013 archiviert wurden, müssen dementsprechend bis 2019 bzw. 2023 aufbewahrt werden. Um genau zu wissen, wie lange Geschäftsakten schon lagern oder gelagert werden müssen, rät der Blitzarchiv-Geschäftsführer Benedikt Steinmetz zu folgendem Vorgehen:
1. Akten sollten strikt nach Entstehungsjahr getrennt aufbewahrt werden.
2. Direkt bei der Einlagerung im Unternehmens- oder externen Archiv sollten die Akten zudem gleich mit der Aufbewahrungszeit bzw. mit dem Vernichtungsdatum gekennzeichnet werden.
3. Dokumente, die gesonderten Aufbewahrungsfristen unterliegen, sollten von den übrigen getrennt verwaltet werden.
"Wer in seinem Aktenlager noch Dokumente seit 2003 oder älter aufbewahrt, kann diese zum Jahresende vernichten, da die Aufbewahrungspflicht - bis auf einige Ausnahmen - erloschen ist", fügt der Blitzarchiv-Geschäftsführer hinzu. "Akten sollten rechtzeitig vernichtet werden, um den Datenschutzbestimmungen zu entsprechen und um die Nutzfläche nicht unnötig mit Aktenbergen zuzustellen. Ganz zu schweigen davon, dass in einem großen Aktenlager die Suche nach bestimmten Dokumenten sehr viel länger dauern würde." Zu den Dokumenten mit gesonderten Aufbewahrungsfristen gehören zum Beispiel Verträge, die sich verlängern wie Mietverträge, behördliche Genehmigungen, Akten aus noch laufenden Verfahren, Baupläne und Gerichtsurteile oder einfach Dokumente, die für ein Unternehmen einen ideellen Wert haben oder bei denen gesonderte Branchenvorschriften (wie bspw. Patientenakten) zu beachten sind.
Von diesen Ausnahmen abgesehen kann man laut Steinmetz grundsätzlich aufbewahrungspflichtige Dokumente in zwei Zeiträume einteilen. Zu den Unterlagen, die zehn Jahre aufbewahrt werden müssen, zählen u. a. Ausgangsrechnungen, Gehaltslisten, Bankbelege, Bewirtungsbelege, Eingangsrechnungen, Fahrtenbücher, Gewinn- und Verlustrechnung (Jahresbilanz), Grundbuchauszüge sowie Buchungsbelege und Steuererklärungen. Hingegen nur sechs Jahre aufbewahrt werden müssen Unterlagen wie Bürgschaften, Bestellungen, Geschäftsbriefe, Darlehensunterlagen, Kassenzettel, Geschenknachweise, Preislisten sowie Einfuhr- und Exportunterlagen.
Steuersparmodell für Familien – Wie Sie Kinderbetreuung durch Angehörige richtig absetzen
Viele Eltern sind berufstätig und können der Aufgabe der Kinderbetreuung nicht ganztägig nachkommen. Diese Aufgaben übernimmt dann oft ein Angehöriger. “Löhne” für die Kinderbetreuung durch Angehörige sind grundsätzlich nicht abziehbar. Ein Kostenersatz, z. B. für Fahrtkosten kann aber steuerlich abgezogen werden. Oft sind in Familien beide Elternteile ganz oder teilweise berufstätig. Der erforderlichen Betreuung ihrer Kinder können sie daher nur teilweise nachkommen. Da für diese Zwecke fremde Personen oft als nicht geeignet oder ggf. zu teuer empfunden werden, behelfen sich viele Familien so, dass sie Angehörige für die Kinderbetreuung einsetzen. Der Gesetzgeber hat aufgrund dieser häufigen Konstellation in den Familien schon seit Jahrzehnten den Abzug von Betreuungskosten für Kinder unter 14 Jahren in der Weise zugelassen, dass 2/3 der Kosten, jedoch max. 4.000 EUR pro Kind, steuerlich abgezogen werden können.
Grundsätzlich können Aufwendungen für einen Babysitter, Erzieher, eine Tages- und Wochenmutter, einen Kindergarten bzw. Kinderhort, eine Kindertagesstätte etc. abgezogen werden. Ein Abzug von Betreuungskosten ist prinzipiell dann ausgeschlossen, wenn die Betreuung durch nahe Angehörige erfolgt. “Hierbei hat sich der Gesetzgeber gedacht, dass möglicherweise bei nahen Angehörigen eine Abgrenzung zu bloßen Gefälligkeitsleistungen schwierig ist”, so Jörg Strötzel, Vorsitzender der VLH. “Daher wollte der Gesetzgeber von vornherein trickreiche, vertragliche Gestaltungen mit Angehörigen ausschließen, um den Abzug bloßer Gefälligkeitsleistungen auf familiärer Grundlage auszuschließen.”
Allerdings hat nun das Finanzgericht Baden-Württemberg mit seinem Urteil vom 09.05.2012, Az. 4 K 3278/11 klargestellt, dass in den Fällen der Kinderbetreuung durch Angehörige, wie z. B. Großeltern, Bruder oder Schwester etc. die Betreuung als solche nicht abziehbar bleibt. Wird jedoch mit den Angehörigen eine unentgeltliche Kinderbetreuung vereinbart und tatsächlich entstehende Fahrtkosten ersetzt, kann dieser tatsächlich gezahlte Fahrtkostenersatz von den Eltern steuerlich als Kinderbetreuungskosten abgesetzt werden. Die VLH empfiehlt daher allen Familien, welche ihre Kinder durch Angehörige betreuen lassen, ggf. durch entsprechende Vereinbarungen mit diesen die Fahrtkosten zu ersetzen. Sie haben dann die Möglichkeit, entweder 2/3 dieser Kosten als Sonderausgaben abzuziehen oder 20 % dieser Aufwendungen direkt von der angefallenen Einkommensteuer abzuziehen.
Den Fiskus “enterben” – Freibetrag alle zehn Jahre nutzen
Die Deutschen sind wohlhabend wie nie zuvor. Auf etwa zehn Billionen Euro beläuft sich das Geld- und Immobilienvermögen der privaten Haushalte in Deutschland. Die Generation der Erben kann demnach mit beträchtlichen Vermögensübertragungen rechnen. Doch auch der Fiskus hält die Hand auf. Allerdings erst, wenn Freibeträge bei Schenkung oder Erbschaft überschritten werden, die je nach Verwandtschaftsgrad unterschiedlich hoch sind.
So gelten nach § 16 Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz grundsätzlich unter anderem folgende Freibeträge für Schenkungen und Erbschaften:
Erst darüber hinaus gehende Vermögensbeträge sind grundsätzlich steuerpflichtig. Je nach Verwandtschaftsgrad wird dann auch ein unterschiedlich hoher Steuersatz angesetzt. Wichtig zu wissen: Die genannten Freibeträge können nach Ablauf von zehn Jahren erneut in Anspruch genommen werden. Bei größeren Familienvermögen kann es also ratsam sein, Schenkungen zu Lebzeiten rechtzeitig zu planen.
Dabei ist zu beachten, dass Vermögensübertragungen zu Lebzeiten innerhalb der Familie vom Finanzamt nur anerkannt werden, wenn sie formalen rechtlichen Vorschriften entsprechen. Im Zweifel kann es sich auszahlen, einen Notar, Steuerberater oder Steuerjuristen zu Rate zu ziehen.
Durch Weiterverschenken die Schenkungssteuer vermeiden
Schenkungen werden häufig aus folgenden zwei Gründen als vorgezogene Erbfolge in Betracht gezogen. Zum einen, um Erbschaftssteuern zu minimieren und zum anderen, da bei Schenkungen unter Lebenden die Vermögensübertragung mit “warmer Hand” erfolgt. Die steuerlichen Schenkungsfreibeträge, die in gleicher Höhe wie die Erbschaftssteuerfreibeträge bestehen, können alle 10 Jahre in voller Höhe neu genutzt werden. Carsten Graf von Rex, Rechtsanwalt in der Steuerberatungs- und Rechtsanwaltskanzlei Roland Franz und Partner in Essen, rät aber von Versuchen ab, Weiterverschenkungen zur Schenkungssteuerminimierung zu nutzen, bzw. rät dazu, sich bei einem solchen Vorhaben gut beraten lassen. “Für die Höhe der Freibeträge kommt es auf das jeweilige Verwandtschaftsverhältnis an. Mit Ausnahme des Verhältnisses zwischen Eheleuten folgt die Steuergesetzgebung bei den Freibeträgen grob dem Grundsatz “wie das Blut so rinnt das Gut”, erklärt Rechtsanwalt Carsten Graf von Rex. So betragen die Freibeträge bei Schenkungen für Ehepartner 500.000,- EUR, für Kinder, Stief- und Adoptivkinder sowie für Enkel, deren Eltern bereits verstorben sind, 400.000,- EUR und für Enkel, deren Eltern noch leben sowie für Urenkel 200.000,- EUR. Eltern, Großeltern, Geschwister, Nichten und Neffen, Stiefeltern, Schwiegerkinder und -eltern sowie geschiedene Ehegatten werden beim Schenkungssteuerfreibetrag wie Nichtverwandte behandelt und haben nur einen Freibetrag in Höhe von 20.000,- EUR. Im Gegensatz zu Nichtverwandten gilt für sie jedoch eine andere Schenkungssteuerklasse und damit geringere Schenkungssteuersätze, die nach der großen Erbschaftssteuerreform zum 01.01.2010 nochmals verbessert worden sind.
“Um die Freibeträge optimal auszunutzen, könnten Schenkungen mit anschließender Weiterverschenkung ins Auge gefasst werden. Dem Missbrauch von rechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten hat der Gesetzgeber in § 42 der Abgabenordnung jedoch einen Riegel vorgeschoben. So sind bei Missbrauch in Form einer unangemessenen rechtlichen Gestaltung die Steuern wie bei einer angemessenen rechtlichen Gestaltung fällig. Ein besonderes Augenmerk legt die Finanzverwaltung dabei auf sogenannte Kettenschenkungen”, so Rechtsanwalt Graf von Rex. Der Bundesfinanzhof hat hier jüngst in einem solchen Fall der Kettenschenkung eine missbräuchliche Gestaltung abgelehnt. In diesem Fall hatte ein Vater seinem Sohn einen Grundstücksanteil unentgeltlich übereignet. Dieser schenkte kurze Zeit darauf die Hälfte seines hälftigen Miteigentumsanteils seiner Frau. Das zuständige Finanzamt nahm daraufhin eine Schenkung des Vaters an die Schwiegertochter an und setzte die Schenkungssteuer in ihrem Bescheid auf 23.200,- EUR fest, da für die Schwiegertochter nur ein Freibetrag von 20.000,- EUR gegolten hätte.
Der Bundesfinanzhof (BFH) lehnte in diesem Fall eine rechtsmissbräuchliche Kettenschenkung ab, da dem Finanzamt kein Beweis für einen schenkungssteuerpflichtigen Vorgang gelang. Entscheidend war hierbei, dass der Sohn nicht aufgrund einer ausdrücklichen Vereinbarung im Schenkungsvertrag oder aus einer sich den Umständen ergebenden Vereinbarung zur Weitergabe verpflichtet war. Wenn der Sohn als Beschenkter den ihm zugewendeten Gegenstand ohne Veranlassung seines Vaters als Schenker und ohne rechtliche Verpflichtung freigiebig seiner Frau weitergibt, scheidet die Annahme einer Schenkung des Vaters an die Schwiegertochter aus. Dieses ist laut einer älteren BFH-Entscheidung auch der Fall, wenn der Schenker weiß oder damit einverstanden ist, dass der Beschenkte den zugewendeten Gegenstand unmittelbar im Anschluss an die Schenkung an einen Dritten weiterschenkt. Im vorliegenden Fall führte der BFH darüber hinaus aus, dass eine Schenkung an die Schwiegertochter an sich schon ungewöhnlich gewesen wäre. Außerdem war bei der Schenkung an die Ehefrau festgelegt worden, dass diese ihren Miteigentumsanteil im Falle der Scheidung von dem Sohn oder dessen Vorversterbens an ihren Schwiegervater hätte rückübereignen müssen.
“Der Fall zeigt, wie intensiv Kettenschenkungen auf Missbrauch hin überprüft werden”, so Rechtsanwalt Graf von Rex.
KPMG-Studie: Vermögensbesteuerung in Deutschland entspricht internationalen Standards
In Zeiten von Finanz-, Wirtschafts- und Haushaltskrisen besteht für Staaten die Notwendigkeit, weitere Einnahmequellen zu erschließen. In Deutschland fordern deshalb viele Politiker ein Comeback der Vermögensteuer, die seit 1997 ausgesetzt ist. Auch in anderen europäischen Ländern sollen Reiche stärker zur Kasse gebeten werden. Eine aktuelle KPMG-Studie vergleicht deshalb die bestehenden deutschen Regelungen zur Besteuerung von Vermögen mit denen in Frankreich, Großbritannien, Italien, den Niederlanden, Österreich, der Schweiz und den USA. Die Publikation, die den Titel "Vermögensteuer - wer besteuert wie?" trägt, betrachtet dabei nicht nur die allgemeine Vermögensteuer, sondern durchleuchtet auch andere vermögensbezogene Steuern wie die Grundsteuer und die Erbschaft- und Schenkungsteuer.
Die Studie kommt zum Schluss, dass in allen untersuchten europäischen Staaten das Aufkommen der Vermögensteuer im Vergleich zu den gesamten Steuereinnahmen von geringerer Bedeutung ist. So machen die vermögensabhängigen Abgaben lediglich zwischen 0,07 und 5 Prozent der gesamten Steuereinnahmen des jeweiligen Landes aus. Einzige Ausnahme und damit absoluter Spitzenreiter ist Frankreich mit 8,6 Prozent. Deutschland liegt im Mittelfeld. Hier machen die Einnahmen aus Vermögen 2,8 Prozent des gesamten Steueraufkommens aus.
Die Betrachtung der einzelnen vermögensbezogenen Steuerarten bringt ein ähnliches Ergebnis zu Tage: Der Anteil der Grundsteuer an den gesamten Steuereinnahmen in Europa liegt zwischen 0,5 Prozent in Österreich und 5 Prozent in Frankreich. Deutschland belegt mit rund 2 Prozent einen mittleren Platz. Das Aufkommen aus der Erbschaft- und Schenkungsteuer spielt in allen Staaten eine eher geringe Rolle. Die Steuereinnahmen betragen zwischen 0,07 Prozent in Italien und 0,8 Prozent in Deutschland. Nur Frankreich nimmt mit 2,4 Prozent eine Sonderrolle ein.
Dr. Martin Lenz, Tax-Partner bei KPMG und verantwortlich für die Studie: "Die derzeitige Vermögensbesteuerung in Deutschland entspricht internationalem Standard. Wir sollten aus diesem europäischen Trend nicht ausscheren, zumal die Verwaltungs- und Erhebungskosten sowohl bei den Finanzbehörden als auch bei den Steuerpflichtigen erheblich sein werden. Insbesondere sollte darauf geachtet werden, dass auch in Krisenzeiten der Fortbestand von Unternehmen nicht gefährdet wird."
Ehegattensplitting - steuerlich nicht immer die beste Lösung
Steuerberaterkammer Stuttgart informiert: Für Ehepaare und eingetragene Lebenspartnerschaften, die beide unbeschränkt einkommensteuerpflichtig sind und nicht dauernd getrennt leben, gilt grundsätzlich, dass die Partner wählen dürfen, welche Art der steuerlichen Veranlagung sie bevorzugen. Dabei können sie sich seit 2013 zwischen der Einzelveranlagung mit Grundtarif und der Zusammenveranlagung mit Splittingtarif entscheiden. Der Hinweis auf "nicht dauernd getrennt lebend" hat nicht zwangsläufig etwas mit einem gemeinsamen Wohnsitz zu tun. Unterhält der eine Partner beispielsweise aus beruflichen Gründen einen anderen Wohnsitz, so ist das steuerlich unschädlich für die gemeinsame Veranlagung. Grundsätzlich geht es um die Abwägung, welche Variante unter welchen Umständen die steuerlich günstigere darstellt.
Veranlagung beantragen
Die von den Steuerpflichtigen gewählte Veranlagungsart ist prinzipiell für ein Steuerjahr gültig. Sie kann in aller Regel nur bis zu dem Zeitpunkt geändert werden, an dem der Steuerbescheid in Kraft tritt. Falls kein Antrag auf Einzelveranlagung gestellt wird, geht das Finanzamt normalerweise davon aus, dass eine Zusammenveranlagung der Ehegatten bzw. eingetragenen Lebenspartner gewünscht wird. Allgemein wird angenommen, dass eine Zusammenveranlagung aufgrund der eintretenden Progressionsmilderung für Ehegatten die günstigere Veranlagungsvariante darstellt. Aber das ist nicht immer so. Wenn also einer der Partner der Meinung ist, die getrennte Veranlagung sei - aus welchen Gründen auch immer - für ihn günstiger, dann kann er, auch einseitig, diese beantragen. Auf die Zustimmung des jeweiligen Partners kommt es in solch einem Fall meistens nicht zwingend an. Bei der Einzelveranlagung findet die Einkommensteuer-Grundtabelle Anwendung, während für die Zusammenveranlagung die sog. Splittingtabelle herangezogen wird.
Zusammenveranlagung
Bei dieser Art der Veranlagung werden die Einkommen der Partner jeweils getrennt ermittelt und dann, vereinfacht dargestellt, gemeinsam bewertet. Die Ermittlung des zu versteuernden Betrages ergibt sich also aus der Summe der beiden Einkommen. Sie bilden insofern die Besteuerungsbasis, als sie zunächst durch zwei geteilt werden, um die Steuer für den hälftigen Betrag zu ermitteln. Der wird dann wieder verdoppelt, um die fälligen Steuern festzulegen. Beispielhaft sei das wie folgt dargestellt: Person A hat ein Einkommen von 40.000 Euro, Person B eines von 20.000 Euro. Gemeinsam verfügen sie also über 60.000 Euro. Davon werden 30.000 Euro als Besteuerungsbasis herangezogen. Der dafür fällige Steuerbetrag liegt bei etwa 5.600 Euro, der dann zu einer Gesamtsteuer von 11.200 Euro führt. Würde jeder sein Einkommen einzeln versteuern, so würde für Person A ein Betrag von knapp 9.000 Euro anfallen, während Person B mit gut 2.600 Euro rechnen müsste. Der zu zahlende Betrag würde somit bei 11.600 Euro und über dem der gemeinsamen Veranlagung liegen. Vereinfacht gilt: Je größer die Einkommensunterschiede, je mehr profitieren die Partner von der gemeinsamen Veranlagung bzw. vom Splittingvorteil.
Einzelveranlagung
Zunächst ist festzuhalten, dass die frühere "getrennte Veranlagung" und die seit 2013 gültige Einzelveranlagung zwar häufig synonym gebraucht werden, sich aber inhaltlich durchaus unterscheiden. So fällt die freie Zuordnung bestimmter steuermindernder Kosten bei der Einzelveranlagung weg. Dies gilt z.B. für die Sonderausgaben, die außergewöhnlichen Belastungen oder die Steuerermäßigungen im Zusammenhang mit haushaltsnahen Dienstleistungen. Sie werden im Gegensatz zur früheren Praxis generell dem Ehegatten zugerechnet, der sie auch wirtschaftlich getragen, sprich bezahlt hat. So wird der zumutbare Anteil bei den außergewöhnlichen Belastungen bei der Einzelveranlagung künftig nach dem Gesamtbetrag der Einkünfte des betroffenen einzelnen Partners und nicht mehr - wie ehemals bei der getrennten Veranlagung - auf Basis der Gesamteinkünfte beider Ehepartner bestimmt. Das kann sich u.U. positiv bei geringem Einkommen eines Partners auswirken, der hohe außergewöhnliche Belastungen zu tragen hat. Es gibt weitere Situationen, in denen die Einzelveranlagung durchaus sinnvoll sein kann. Dabei spielt häufig der sog. Progressionsvorbehalt eine entscheidende Rolle. Er kommt dann ins Spiel, wenn einer der Partner beispielsweise hohe steuerfreie Einkünfte hat, die allerdings bei der Berechnung des Steuersatzes für die gesamten Einkünfte eines Paares nach der Splittingtabelle Berücksichtigung finden. Sie können zu einer höheren Besteuerung führen, als das bei einer Einzelveranlagung der Fall wäre. Dazu gehören Entgelt-, Lohn- und Einkommensersatzleistungen wie etwa Arbeitslosen-, Kranken-, Mutterschafts- oder Elterngeld. Im Detail regelt § 32b EStG, welche Leistungen und Einkünfte dem Progressionsvorbehalt unterliegen und in welcher Größenordnung sie, ggf. unter Abzug von Werbungskosten, steuerrelevant sind. Generell gibt es eine Reihe von Vorteilen, die eine Einzelveranlagung mit sich bringen kann, z.B. bei Verlustvorträgen oder Kirchensteuer, so dass stets im Einzelfall zu prüfen ist, welche Veranlagungsart für die individuelle Lebenssituation die günstigere ist.
Fazit
Die Wahl der Veranlagungsarten kann diverse steuerliche Konsequenzen mit sich bringen, die für den Laien nicht ohne weiteres durchschaubar sind. Zur Beurteilung der vielfältigen Aspekte und der Wahl einer individuell optimalen Lösung empfiehlt es sich deshalb, einen Steuerberater hinzuzuziehen.