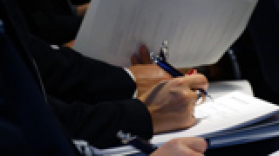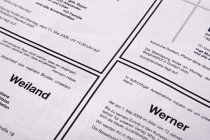Mit klarem Kompass durch den Paragrafendschungel: Die fünf wichtigsten Tipps für eine erfolgreiche Rechtsberatung
Wer sich in rechtlichen Fragen an einen Anwalt wendet, steht oft vor einer Situation, die Unsicherheit und viele Fragen mit sich bringt. Damit Sie von einer Rechtsberatung optimal profitieren, sollten Sie sich gezielt vorbereiten und einige Grundregeln beachten. Im Folgenden finden Sie die fünf wichtigsten Tipps von Verbraucherfinanzen-Deutschland.de, die Ihnen helfen, das Beste aus Ihrem Beratungsgespräch herauszuholen und Ihre Interessen wirkungsvoll zu vertreten.
1. Ehrlichkeit ist Trumpf: Schildern Sie den Sachverhalt vollständig und unverblümt
Viele Mandanten neigen dazu, ihre Situation zu beschönigen oder unangenehme Details zu verschweigen. Doch nur, wenn Sie Ihrem Anwalt alle Fakten offenlegen – auch die, die Sie selbst belasten könnten –, kann er Sie wirksam und zu Ihrem Vorteil beraten. Anwälte unterliegen der Schweigepflicht, alles Gesagte bleibt also vertraulich. Ihr Anwalt steht auf Ihrer Seite und kann nur dann die beste Strategie entwickeln, wenn er die vollständige Wahrheit kennt.
2. Klare Ziele setzen: Was wollen Sie erreichen?
Bevor Sie das Gespräch mit dem Anwalt suchen, sollten Sie sich selbst darüber klar werden, welches Ergebnis Sie anstreben. Geht es Ihnen um Schadensersatz, eine Abfindung, die Rückgabe einer Ware oder die Abwehr einer Forderung? Nur wenn Sie Ihre Ziele klar formulieren, kann Ihr Anwalt gezielt darauf hinarbeiten und die passende Strategie entwickeln.
3. Vorbereitung ist die halbe Miete: Unterlagen und Fakten sortieren
Sammeln Sie im Vorfeld alle relevanten Dokumente, Verträge, Schriftwechsel und Notizen, die mit Ihrem Fall zu tun haben. Je besser Sie vorbereitet sind, desto schneller und effektiver kann der Anwalt sich ein Bild machen und Sie beraten. Notieren Sie sich außerdem die wichtigsten Fakten und den Ablauf der Ereignisse in chronologischer Reihenfolge – das hilft, im Gespräch nichts zu vergessen und den Sachverhalt klar zu schildern.
4. Kosten im Blick behalten: Transparenz schaffen
Sprechen Sie das Thema Kosten gleich zu Beginn offen an. Lassen Sie sich eine grobe Einschätzung geben, welche Gebühren und Auslagen auf Sie zukommen können. So vermeiden Sie böse Überraschungen und können abwägen, ob das Kosten-Nutzen-Verhältnis für Sie stimmt. Falls Sie eine Rechtsschutzversicherung haben, bringen Sie die Police zum Gespräch mit.
5. Den passenden Anwalt wählen: Fachkompetenz und Vertrauen zählen
Nicht jeder Anwalt ist für jedes Rechtsgebiet der richtige Ansprechpartner. Suchen Sie gezielt nach einem Spezialisten für Ihr Anliegen – etwa im Arbeitsrecht, Mietrecht oder Verbraucherrecht. Achten Sie auf Erfahrung, Bewertungen und darauf, ob Sie sich beim Erstgespräch gut aufgehoben fühlen. Die persönliche Chemie und das Vertrauen sind entscheidend für eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Scheuen Sie sich nicht, nach dem ersten Gespräch zu wechseln, wenn das Bauchgefühl nicht stimmt.
Mit diesen fünf Tipps sind Sie bestens gerüstet, um Ihre Rechtsberatung effektiv zu gestalten. Eine gute Vorbereitung, Offenheit und die Wahl des richtigen Anwalts sind der Schlüssel, um Ihre Interessen erfolgreich durchzusetzen – und den Paragrafendschungel sicher zu durchqueren.
Aktuelle Recherchetipps der Redaktion mit Verlinkung
Testen und vergleichen Sie! Top-Recherchetipps!
Ausführliche Vergleiche zum Thema Rechtsanwälte in der aktuellen Ausgabe von Geldwertmagazin 2026 ab der Seite 164
Hier kommen Sie zur kostenfreien Online-Ausgabe des Geldwertmagazin 2026
Kein Kita-Platz weit und breit? – Was Eltern zum Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung wissen sollten
Seit dem 1. August 2013 haben Eltern in Deutschland einen gesetzlichen Anspruch auf einen Betreuungsplatz für Kinder ab dem ersten Lebensjahr – soweit die Theorie. In der Praxis suchen viele verzweifelte Eltern oft lange nach Unterstützung, um Beruf und Familie unter einen Hut zu bringen. Anspruch und Wirklichkeit klaffen in vielen Regionen weit auseinander. Aber was tun, wenn weit und breit kein Kita- oder Kindergartenplatz in Sicht ist? ROLAND-Partneranwalt Ansgar Bigge von der Sozietät Bietmann Rechtsanwälte Steuerberater PartmbB erklärt alles Wichtige zum Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung.
Wer hat Anspruch auf Kinderbetreuung?
Der deutschlandweite Anspruch auf Kinderbetreuung für Kinder zwischen einem und drei Jahren wurde im Sozialgesetzbuch rechtlich verankert. Außerdem gilt schon länger, dass alle Kinder ab dem vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt, das Recht auf einen Kindergartenplatz haben. „Grundsätzlich haben damit alle Eltern, die ihre Kinder nicht selbst betreuen können, Anspruch auf einen Betreuungsplatz“, erläutert Ansgar Bigge, Partneranwalt von ROLAND Rechtsschutz. „Dennoch gibt es für Eltern leider oftmals keine Garantie, dass ihr Kind tatsächlich betreut werden kann.“
Auch wenn der Bund seit einigen Jahren den Ausbau der Betreuungsplätze massiv vorantreibt, ist die regionale Verteilung sehr unterschiedlich. In vielen Städten und Orten sind die vorhandenen Kapazitäten in Kindertagesstätten oder Kindergärten oft überlastet, und die Wartelisten scheinen endlos zu sein. „In solchen Fällen ist es wichtig, dass Eltern ihre Rechte kennen und wissen, wie sie vorgehen können, um den gesetzlichen Anspruch auf Kinderbetreuung durchzusetzen“, so der Experte für Zivilrecht.
Was sollten Eltern beachten?
Es ist besonders wichtig, dass Eltern frühzeitig bei der Suche nach einem Platz aktiv werden. „Bei einer Wunscheinrichtung können sich Eltern direkt anmelden, zusätzlich sollten sie den Anspruch bei den örtlichen Jugendämtern geltend machen“, erklärt Rechtsanwalt Bigge. Die entsprechenden Kita-Formulare für den Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung sind auf den Websites der meisten Jugendämter zu finden. Der Platz sollte allerspätestens drei Monate, besser mindestens sechs Monate, vor dem geplanten Kitabesuch angemeldet werden, um rechtzeitig berücksichtigt werden zu können. „Es ist wichtig, frühzeitig zu handeln, um alternative Möglichkeiten zu prüfen und gegebenenfalls den Betreuungsplatz rechtlich einzufordern“, rat ROLAND-Partneranwalt Bigge. „Erst wenn das Jugendamt keinen freien Platz zur Verfügung stellen konnte, ergeht ein Ablehnungsbescheid, welcher wiederum das Widerspruchs- und Klageverfahren eröffnet.“
Kommunen sind verpflichtet, Eltern zumutbare Kinderbetreuungsplätze anzubieten. Die Zumutbarkeit wird von den Verwaltungsgerichten am jeweiligen Fall bestimmt. Als grobe Richtlinie wird aber eine Wegstrecke vom Wohnort zur Einrichtung von nicht mehr als 30 Minuten als zumutbar angenommen. „Wenn trotz rechtzeitiger Anmeldung und eigener Bemühungen kein zumutbarer Betreuungsplatz vom Jugendamt zur Verfügung gestellt werden kann, wird der Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung nicht erfüllt“, hält der ROLAND-Anwalt fest. Achtung: wer einen zumutbaren Kinderbetreuungsplatz ablehnt, verliert seine Schadensersatzansprüche!
Kein Betreuungsplatz – welche Möglichkeiten gibt es?
Sobald der Ablehnungsbescheid des Jugendamts im Briefkasten angekommen ist, muss in den meisten Bundesländern innerhalb eines Monats Widerspruch eingelegt werden. Ab diesen Zeitpunkt haben Eltern verschiedene Optionen, um ihren Anspruch juristisch geltend zu machen.
„Nachdem die Ablehnung durch das Jugendamt vorliegt, besteht die Möglichkeit, den Betreuungsplatz beim zuständigen Verwaltungsgericht einzuklagen. Die Klagen haben Erfolg, wenn freie Plätze zur Verfügung stehen bzw. sich die Kapazität der Kindertagesstätten erweitern lässt“, erklärt Bigge. Auch hier ist es wichtig, möglichst schnell zu handeln, da die Zeit bis zur benötigten Betreuung oft drängt. „In solchen Fällen sollten Eltern unbedingt ein Eilverfahren beantragen, das meist innerhalb weniger Wochen entschieden wird.“
„Sollten tatsächlich keine zumutbaren Betreuungsplätzen angeboten werden können, haben die Eltern Ersatzansprüche gegenüber der Kommune“, so Rechtsanwalt Bigge weiter. Es besteht die Möglichkeit, sich nach alternativen Betreuungsmöglichkeiten bei privaten Anbietern umzuschauen. Die Mehrkosten im Vergleich zur öffentlichen Kita können dann gegenüber der Kommune eingeklagt werden.
Ebenso kann auch die Erstattung von Verdienstausfällen, die durch die fehlende Kinderbetreuung entstehen, gerichtlich eingefordert werden. Der Schadensersatz wird beim zuständigen Landgericht eingeklagt.
„Eltern haben einen gesetzlichen Anspruch auf Kinderbetreuung ab dem ersten Lebensjahr und sollten diesen – wenn nötig – auch rechtlich durchsetzen. Wenn keine zumutbaren Kitaplätze zur Verfügung gestellt werden, haben Eltern Anspruch auf Schadensersatz“, so das Fazit von ROLAND-Partneranwalt Bigge.
Notvertretungsrecht für Ehepaare und Lebenspartnerschaften
Neue Regelungen für medizinische Notfälle
Ein Unfall, Schlaganfall oder Herzinfarkt – ganz plötzlich kann jemand nicht mehr in der Lage sein, seinen Willen zu äußern. Ohne Vollmacht konnten auch Ehepartner hier bisher nicht einspringen. Seit dem 1. Januar 2023 ist das anders: Welche rechtlichen Regelungen jetzt gelten, worauf Eheleute achten müssen und warum Vollmachten und Co. trotzdem sinnvoll sind, erklärt Michaela Rassat, Juristin der ERGO Rechtsschutz Leistungs-GmbH.
Vertretung bisher nur mit Vollmacht
In medizinischen Notfällen, in denen sich der Betroffene selbst nicht mehr äußern kann, durften Ehe- oder Lebenspartner bisher nur mit einer Vorsorgevollmacht Entscheidungen übernehmen. „Ansonsten bekamen Betroffene vom Betreuungsgericht einen Betreuer zur Seite gestellt“, so Michaela Rassat, Juristin der ERGO Rechtsschutz Leistungs-GmbH. Seit Jahresbeginn 2023 hat sich die Rechtslage geändert. „Laut dem neuen § 1358 des Bürgerlichen Gesetzbuches dürfen sich nun verheiratete oder in einer Lebenspartnerschaft lebende Paare in medizinischen Notfällen gegenseitig vertreten – auch ohne Vollmacht“, so die Juristin.
Neue Rechte für Ehepaare und Lebenspartnerschaften
Das heißt zum Beispiel, dass Ehepartner zu operativen Eingriffen oder vorgeschlagenen Untersuchungen schnell Entscheidungen fällen können. „Darüber hinaus sind sie zum Beispiel auch dazu berechtigt, sich um die Kommunikation mit dem Krankenhaus oder eilige Reha-Maßnahmen zu kümmern“, erläutert Rassat. Allerdings gilt: Finanzielle Angelegenheiten des Patienten sind tabu und auch Verträge darf die vertretende Person nur abschließen, wenn diese für medizinische Behandlungen, Reha-Maßnahmen oder Pflege nötig sind. „Ein Auto im Namen des Ehepartners zu kaufen ist beispielsweise nicht möglich“, so die ERGO Juristin.
Nur sechs Monate
Das Notvertretungsrecht gilt allerdings nur für sechs Monate – ohne Vollmacht übernimmt anschließend ebenfalls ein gesetzlicher Betreuer. In diesem Zeitraum sind die behandelnden Ärzte von der Schweigepflicht gegenüber dem Ehepartner entbunden. Das heißt: Ärzte dürfen ihn über alles aufklären, was die Gesundheit des Partners betrifft und müssen ihm Auskunft dazu geben.
Wann das Notvertretungsrecht nicht gilt
In einigen Ausnahmefällen ist eine gegenseitige Vertretung bei Eheleuten und Lebenspartnern jedoch nicht möglich. „Gibt es beispielsweise eine Vorsorgevollmacht oder ist bereits ein gesetzlicher Betreuer bestellt, greift das Notvertretungsrecht nicht“, erläutert Rassat. Weitere Ausnahmen sind: Getrennt lebende Paare oder wenn die erkrankte Person einer Vertretung durch ihren Partner explizit widersprochen hat. „Ein solcher Widerspruch gegen das Notvertretungsrecht kann im Zentralen Vorsorgeregister der Bundesnotarkammer hinterlegt werden“, so die Juristin der ERGO Rechtschutz Leistungs-GmbH. Seit 1. Januar 2023 erhalten Ärzte diese Auskunft über ein automatisiertes Abrufverfahren.
Schriftliche Bestätigung als Beweis
Außerdem wichtig zu wissen: Der Partner muss gegenüber dem behandelnden Arzt schriftlich bestätigen, dass er das Notvertretungsrecht bisher nicht ausgeübt hat und dass keiner der gesetzlichen Ausschlussgründe vorliegt. Auch der Arzt muss eine schriftliche Bestätigung erstellen, dass die erkrankte Person sich nicht mehr selbst um ihre gesundheitlichen Angelegenheiten kümmern kann. Diese Bestätigung kann der Partner dann gegenüber anderen Stellen, etwa einer Reha-Klinik, vorlegen, um sein Notvertretungsrecht zu beweisen“, ergänzt Rassat.
Mit Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung bestmöglich abgesichert
Trotz Notvertretungsrecht rät die ERGO Juristin, eine Vorsorgevollmacht zu erstellen. Nicht nur, weil das Notvertretungsrecht nur sechs Monate gilt, sondern auch weil eine Vorsorgevollmacht dem Partner erlaubt, beispielsweise auch finanzielle oder versicherungstechnische Angelegenheiten ohne Gesundheitsbezug zu regeln. Eine zusätzliche Patientenverfügung kann dem Partner zudem dabei helfen, die Entscheidungen umzusetzen, die sich der Betroffene wünscht.
Vorsorgevollmacht leicht gemacht
Die Verbraucherzentralen bieten online eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung an.
Nach der Patientenverfügung sind nun auch Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung online leicht erstellbar.
Grundlage sind verlässliche Textbausteine des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz.
Schnell und bequem von zu Hause eine ganz persönliche Patientenverfügung erstellen – das geht seit November letzten Jahres mit der Online-Patientenverfügung der Verbraucherzentralen. Auf Wunsch vieler Nutzer:innen dieses Tools gibt es nun im interaktiven Angebot "Selbstbestimmt" zusätzlich auch eine Online-Vorsorgevollmacht und eine Online-Betreuungsverfügung. Dieser neue kostenfreie Service der Verbraucherzentralen erleichtert die Erstellung der wichtigen Dokumente für den Ernstfall. Grundlage sind Formulare, die das Bundesministerium der Justiz entwickelt hat.
Mit Hilfe des neuen Online-Services der Verbraucherzentralen können Verbraucher:innen nun Schritt für Schritt mit leicht verständlicher Anleitung eine Vorsorgevollmacht oder eine Betreuungsverfügung zusammenstellen. Erklärtexte und Hinweise helfen dabei, die Tragweite der eigenen Entscheidung zu verstehen. Am Ende erhalten die Nutzer:innen auf sie abgestimmte Vorsorgedokumente. Damit diese gültig sind, müssen sie ausgedruckt und unterschrieben werden.
"In unserem Austausch mit Verbraucher:innen stellen wir immer wieder fest, dass das Interesse an den Vorsorgeverfügungen groß ist. Viele Menschen haben aber Angst, etwas falsch zu machen und bleiben vielfach auf halber Strecke stehen. Wir bauen mit unserem neuen Online-Angebot Hürden ab", sagt Verena Querling, Pflegerechtsexpertin der Verbraucherzentrale NRW. "Der Weg zu einer fertigen Vorsorgevollmacht wird dadurch für viele Menschen leichter."
Darum ist die Vorsorgevollmacht so wichtig
Eine Vorsorgevollmacht oder eine Betreuungsverfügung sind wichtige Dokumente für den Fall, dass eine Vertrauensperson sich um die wichtigsten Angelegenheiten kümmern soll, wenn man dazu selbst nicht mehr in der Lage ist. Wer hier nicht vorsorgt, riskiert, dass eine fremde Person vom Gericht als Betreuer:in bestellt wird, etwa wenn man sich plötzlich durch Unfall, Krankheit oder Alter nicht mehr selbst äußern kann. Um hier vorzusorgen, gibt es zwei Möglichkeiten:
Mit einer Vorsorgevollmacht lässt sich regeln, wer welche wichtigen Entscheidungen treffen darf, wenn man es selbst nicht mehr kann.
In einer Betreuungsverfügung lässt sich festlegen, welche Person vom Betreuungsgericht als Betreuer:in eingesetzt werden soll. Betreuer:innen werden vom Gericht kontrolliert.
Weitere Informationen und Links
Schritt-für Schritt-Anleitung und Bausteine unter www.verbraucherzentrale.nrw/selbstbestimmt
Vorsorgevollmacht: Alle ab 18 Jahren sollten eine haben
Es kann schnell gehen, dass ein Mensch nicht mehr für sich selbst entscheiden kann. Künstliche Ernährung, Beatmung, wie soll es weitergehen im Fall der Fälle? Eine Vorsorgevollmacht hilft, klare Entscheidungen im Sinne des Patienten zu treffen. Hier wird alles geregelt, was auftreten kann, wenn jemand zeitweise oder dauerhaft nicht mehr entscheidungsfähig ist. Was in einer solchen Vollmacht alles geregelt wird, erklärt die Mai-Ausgabe von Finanztest.
„In einer Vorsorgevollmacht legt ein Mensch schriftlich fest, wer ihn vertreten und rechtsverbindliche Erklärungen abgeben darf, wenn er oder sie es selbst nicht kann – egal ob temporär oder dauerhaft“, erklärt Finanztest-Redakteurin Simone Weidner. Sie rät, die rechtliche Vorsorge nicht vor sich herzuschieben, sondern sich frühzeitig darum zu kümmern: „Besprechen Sie in gesunden Zeiten mit Angehörigen oder im Freundeskreis wie es weitergehen soll, wenn Sie wegen Krankheit, Unfall oder Alter nicht mehr können.“ Vorsorgevollmacht, aber auch Patientenverfügung und Betreuungsverfügung sind hier die entscheidenden Dokumente. Damit im Ernstfall alles so abläuft, wie der Patient es verfügt hat, sollte man eine solche Erklärung auf jeden Fall aufmerksam ausfüllen, damit an alles gedacht ist. Finanztest gibt in einem großen Übersichtsartikel verlässliche Unterstützung. Wie findet man eine Vertrauensperson? Wie werden die Aufgaben festgelegt? Braucht man auch eine Bankvollmacht? Was gilt für Ehepaare? Und wie sehen Betreuungs- und Patientenverfügung eigentlich aus? Schließlich liefert das Magazin noch Tipps zum Überwinden von Hindernissen, die aus Erfahrung oft auftreten.
Fallbeispiele aus dem wirklichen Leben helfen, die möglichen Situationen und Beweggründe fürs Kümmern zu verstehen. „Wir wollen es den Menschen einfach machen, damit schwierige Dinge nicht zu einer Katastrophe werden“, so Simone Weidner. Und wenn jemand gar nichts regelt? „Dann regen Ärzte beim Gericht eine Betreuung an, dort wird dann bestimmt, wer für einen kranken Menschen als gesetzlicher Betreuer die anstehenden Entscheidungen fällt. Das können Angehörige sein oder auch hauptberufliche Betreuer.“
Mein Wille zählt: Für den Ernstfall vorsorgen
Ob durch einen Unfall, eine Krankheit oder altersbedingt: Viele Menschen haben Angst davor, auf die Unterstützung anderer angewiesen zu sein. Umso wichtiger sind klare Regelungen für den Ernstfall. Das Infocenter der R+V Versicherung rät, frühzeitig und juristisch wasserdichte Vorsorgeregeln zu erstellen.
Mehr als 40 Prozent der Deutschen befürchten, im Alter zum Pflegefall zu werden. Das zeigt die R+V-Langzeitstudie "Die Ängste der Deutschen". Bei den über 60-Jährigen ist diese Sorge besonders ausgeprägt. "Doch ein Unfall oder eine Krankheit kann auch jüngere Menschen treffen. Für sie sind Vollmachten oder Verfügungen deshalb genauso wichtig", sagt Michael Pühler, Rechtsexperte bei der R+V Versicherung. Betroffene sollten ihre Wünsche schriftlich festhalten, etwa zur Pflege, zur Betreuung oder zu den Finanzen.
Gibt es keine Vollmachten oder Verfügungen, kann ein Gericht eine fremde Betreuerin oder einen Betreuer bestimmen. Was viele nicht wissen: "Weder Ehepartner noch Kinder können automatisch Entscheidungen übernehmen. Sie müssen dazu bevollmächtigt sein", erklärt R+V-Experte Pühler.
Mit einem Testament kann jeder seinen Nachlass regeln - ganz gleich, was zu vererben ist. Wichtig ist, das Testament vollständig selbst mit der Hand zu schreiben und am Ende mit Vor- und Nachnamen zu unterzeichnen. Liegt der letzte Wille nicht schriftlich vor, gilt die gesetzliche Erbfolge.
Eine Patientenverfügung legt fest, welchen medizinischen Behandlungen oder ärztlichen Eingriffen zugestimmt wird und welchen nicht. "Sie kommt beispielsweise zum Tragen, wenn der oder die Betroffene nicht mehr ansprechbar ist", erklärt Pühler. Ist die Patientenverfügung ungenau formuliert oder liegt keine vor, entscheidet ein Betreuer mit dem Arzt oder der Ärztin über die weiteren Behandlungen.
Wenn jemand nicht mehr selbst entscheiden kann, muss ein anderer das übernehmen. "Mit einer Vorsorgevollmacht legt man fest, wer die eigenen Interessen vertritt - und was er entscheidet", so Pühler. Dazu gehören viele Dinge des täglichen Lebens: etwa Mietzahlungen, Behördengänge, Bankgeschäfte, Vertretung vor Gericht und alle Aspekte rund um die Pflegebedürftigkeit. Die Vorsorgevollmacht kann auch auf mehrere Personen verteilt werden.
Mit der Betreuungsverfügung kann jeder im Voraus entscheiden, wen das Gericht als rechtlichen Betreuer einsetzen soll - und wen nicht. "Hier wählen viele einen vertrauten Menschen", sagt Pühler. Die Verfügung kann auch konkrete Wünsche enthalten, etwa die Pflege daheim. "Die betreuende Person kümmert sich jedoch nur um die rechtliche Umsetzung, setzt sie aber nicht selbst um." Wer eine detaillierte Vorsorgevollmacht hat, kann in der Regel auf eine Betreuungsverfügung verzichten.
Mit einer Sorgerechtsverfügung können Eltern festhalten, wer nach ihrem Tod die minderjährigen Kinder betreuen soll. Das können auch zwei Personen sein, die sich die Aufgabe teilen. Erkranken Eltern schwer und können sich nicht mehr um ihre Kinder kümmern, lässt sich das Sorgerecht übertragen. Dafür gibt es die Sorgerechtsvollmacht. Wenn die Eltern nicht vorsorgen, entscheidet ein Gericht mit dem Jugendamt über den Vormund.
Eine Vollmacht oder Verfügung sollte so konkret wie möglich verfasst sein. "So wissen Ärzte, Betreuer, Erben, Gerichte genau, wie sie im Sinne des Betroffenen handeln sollen", erklärt Michael Pühler. Wer beim Verfassen auf Nummer Sicher gehen möchte: Bei vielen Krankenkassen, Versicherungen oder Behörden gibt es Vordrucke zum Ausfüllen. Bei rechtlichen Aspekten ist notarielle Beratung hilfreich, in allen medizinischen Fragen ärztlicher Rat.
Betrug: BaFin warnt vor gefälschten Zahlungsaufforderungen
Aktuell haben Bürgerinnen und Bürger per E-Mail vermeintliche Zahlungsaufforderungen im Namen der BaFin erhalten. Darin werden sie zu Überweisungen aufgefordert, um Geld zurückzuerhalten, das in nicht-lizenzierte Online-Handelsplattformen investiert sei. Zudem wird ein angeblicher Sicherheitsvertrag der BaFin mitgeschickt, bei dem es sich um eine Fälschung handelt.
Zur Kontaktaufnahme verwenden die unbekannten Personen die E-Mail-Signatur „BAFIN Team“ und geben zur weiteren Korrespondenz den Namen des vermeintlichen Mitarbeiters Dr. Gottlob Berger an. Bei der BaFin ist keine Person mit dem genannten Namen beschäftigt.
Die Aufsicht empfiehlt allen Verbraucherinnen und Verbrauchern, die ein derartiges Hilfsangebot erhalten, sich keinesfalls darauf einzulassen und Anzeige bei der Polizei oder Staatsanwaltschaft zu erstatten. Wer Zweifel hat, kann sich auch an die BaFin selbst wenden. Das Verbrauchertelefon ist kostenfrei unter der Telefonnummer 0800 2 100 500 zu erreichen.
Die BaFin wendet sich nicht von sich aus an einzelne Personen. Verbraucher sollten generell äußerst wachsam sein, wenn Dritte unter dem Namen der BaFin agieren.
Miese Masche: Betrug an Senioren
Seit Beginn der Corona-Krise werden immer mehr ältere Menschen Opfer von Trickbetrügern. Die Kriminellen nutzen Isolation und Ängste der Menschen aus und münzen bekannte Betrugsstrategien auf die Pandemie um. Wer ihre Maschen kennt, kann sich besser schützen.
„Bleiben Sie zu Hause“: Die Deutschen haben wohl noch nie so viel Zeit zu Hause verbracht wie während der Corona-Krise. Schlechte Zeiten für Einbrecher und Taschendiebe. Aber offenbar beste Bedingungen für Betrüger, die ältere Menschen im Visier haben: Allein in NRW stieg die Zahl der auf Senioren zielenden Betrugsdelikte – wie Enkeltrick oder falsche Amtsträger – im Vergleich von 2019 zu 2020 um knapp 38 Prozent, zitiert das Landeskriminalamt NRW die Polizeiliche Kriminalstatistik. Zwar sei das Risikobewusstsein der über 65-Jährigen im öffentlichen Raum hoch – beispielsweise führen ältere Personen weniger Bargeld bei sich. Aber: „In ihren vermeintlich sicheren vier Wänden erkennen Seniorinnen und Senioren das kriminelle Vorgehen von Täterinnen und Tätern oft nicht oder sind in spontanen Tatsituationen derart überrascht, dass sie das vorhandene Wissen hierüber nicht abrufen können“, berichtet Kriminalhauptkommissar Udo Rechenbach.
Falscher Enkel hat Corona
Das Überraschungsmoment, gepaart mit emotionalem Druck, nutzen die Kriminellen beispielsweise beim Enkeltrick. Bei dieser perfiden Masche ruft der Betrüger sein potenzielles Opfer an und gibt sich als naher Verwandter aus, der in eine Notsituation geraten ist und finanzielle Hilfe benötigt. Aktueller Aufhänger: Ein Angehöriger habe sich mit Covid-19 infiziert, liege im Krankenhaus und benötige dringend Geld, um die ärztliche Behandlung zu bezahlen. Willigt das Opfer ein, holt ein Bote das Geld ab oder begleitet das Opfer sogar zur Bank, um Ersparnisse vom Konto abzuheben. Der Schaden bei dieser Betrugsmasche kann außerordentlich groß sein: „Fällt das Opfer auf den Trick herein, ist oftmals das über Jahrzehnte angesparte Vermögen auf einen Schlag weg“, warnt Anja Maultzsch, Expertin für Seniorenfragen bei der Postbank. Gerade während der Pandemie waren Senioren anfällig für Straftaten dieser Art, weil sie oft allein zu Hause waren.
Vorsicht: manipulierte Rufnummer
Auf demselben Prinzip wie der Enkeltrick basiert die Masche „Falsche Amtsträger“: Dabei ruft ein vermeintlicher Polizeibeamter oder Mitarbeiter des Gesundheitsamtes das potenzielle Opfer mit einer manipulierten Nummer an, sodass 110 oder eine andere bekannte Nummer im Display erscheint. Der Anrufende behauptet, der Wohnort des Betroffenen sei unter Quarantäne gestellt worden und müsse untersucht oder desinfiziert werden. Auf diese Weise verschaffen sich die Kriminellen Zugang zur Wohnung des Opfers, wo sie es auf Bargeld und Wertgegenstände abgesehen haben. „Es ist wichtig, nicht nur die älteren Menschen selbst, sondern auch ihr soziales Umfeld für diese Form des Betrugs zu sensibilisieren und mit den neuesten Erkenntnissen über die Vorgehensweise der Täter vertraut zu machen,“ sagt die Postbank Expertin. „Wissen ist der beste Schutz, um derartige Straftaten zu verhindern.“
Vorsicht vor falschen Verbraucherschützern
Dubiose Geschäftemacher geben sich derzeit als Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter der Verbraucherzentrale Hamburg aus, um Verbraucherinnen und Verbraucher am Telefon zu täuschen. Die Hamburger Verbraucherschützer haben mehrere Hinweise von Betroffenen erhalten. „Die Betrüger verwenden den Namen der Verbraucherzentrale, um das Vertrauen der Angerufenen zu gewinnen und ihnen dann das Geld aus der Tasche zu ziehen“, warnt Julia Rehberg von der Verbraucherzentrale Hamburg. Die Maschen der unseriösen Trittbrettfahrer sind vielfältig.
Falsche Umfrage zur Pflegebedürftigkeit
Ein Verbraucher berichtete von einem Anrufer, der sich als Mitarbeiter der Verbraucherzentrale Hamburg vorstellte und vorgab, eine Umfrage zur Pflegebedürftigkeit durchzuführen. Der Verbraucher teilte dem Anrufer einige Auskünfte mit, wurde aber misstrauisch, als der vermeintliche Verbraucherschützer ihm plötzlich ein „unverbindliches Angebot“ unterbreitete. „Wir kontaktieren niemanden, um Beratungen oder andere Dienstleistungen zu bewerben oder anzubieten“, erklärt Rehberg. Sie rät dazu, sich nicht auf am Telefon oder per E-Mail unterbreitete Angebote einzulassen. „Meist bleibt die versprochene Leistung aus, das gezahlte Geld ist verloren und die persönlichen Daten sind in den falschen Händen.“
Angebliche Gewinnspiele
Das Abfischen von Daten ist auch das Ziel einer weiteren Masche, von der eine Verbraucherin berichtete. Diese erhielt mehrere Anrufe, in denen sich ihr Gesprächspartner als Mitarbeiter der Verbraucherzentrale Hamburg vorstellte und die Betroffene aufforderte, eine Zahl zwischen eins und zehn zu nennen. Mit der richtigen Zahl könne sie das Überraschungspaket einer Verlosung gewinnen, an der sie laut des angeblichen Verbraucherschützers zuvor teilgenommen habe. Die Verbraucherin beendete das Gespräch und informierte die Verbraucherzentrale Hamburg. „Die persönlichen Daten oder sogar eine Kontoverbindung sollen oft angegeben werden, um den versprochenen Gewinn zu erhalten. Doch diese Informationen sollte man keinesfalls preisgeben“, so Rehberg. „Soll vorab sogar noch ein Geldbetrag an einen unbekannten Empfänger überwiesen werden, sollte man sofort auflegen.“
Zwangsvollstreckung über 9.800 Euro
Ein dritter Verbraucher berichtete von einem Anrufer, der sich als „Herr Kahn“ von der Verbraucherzentrale Hamburg vorstellte und den Betroffenen darüber informierte, dass gegen ihn eine Zwangsvollstreckung in Höhe von 9.800 Euro vorliegen würde. Diese hätte der Anbieter eines Gewinnspiels gegen ihn erwirkt. Der Betrüger teilte dem Verbraucher die Telefonnummer eines Rechtsanwalts mit, der angeblich kostenlos helfen könne, die Zwangsvollstreckung zu stoppen. Statt den empfohlenen Rechtsanwalt zu kontaktieren, wendete sich der Verbraucher an die Verbraucherzentrale Hamburg. Diese teilte ihm mit, dass weder der angebliche Mitarbeiter noch die Nummer, über die der Betrüger den Verbraucher kontaktiert hatte, bekannt sei.
„Wer auf einen betrügerischen Anruf reingefallen ist, sollte auf jeden Fall Strafanzeige erstatten. Das ist auch online möglich. Notieren Sie sich zudem die Nummer und informieren Sie die Bundesnetzagentur“, rät Rehberg.
Vorsorgevollmacht? Nur in die richtigen Hände!
Ältere Menschen werden häufiger Opfer von Trickbetrug und Täuschungen als junge. Erschleichen sich Betrüger Vollmachten, ist schnell das gesamte Vermögen in Gefahr. Vollmachtgeber sollten gut überlegen, wem sie vertrauen.
Vollmachten können in den falschen Händen großen Schaden anrichten
Kriminelle nehmen ganz gezielt ältere Menschen ins Visier, weil sie bei ihnen leichte Beute vermuten. Zwar tauchen Senioren – im Verhältnis zu ihrem hohen Anteil an der Gesamtbevölkerung – selten in Polizeistatistiken auf, trotzdem werden sie vergleichsweise häufig Opfer ganz bestimmter Straftaten. Besonders beliebt bei den Tätern ist die finanzielle Ausbeutung Älterer durch Trickbetrug oder Täuschung. „Die Täter nutzen ganz gezielt körperliche und kognitive Schwächen und auch emotionale Tiefs älterer Menschen aus“, erklärt Anja Maultzsch von der Postbank. Während hinter windigen Haustürgeschäften, der Abzocke durch falsche Polizisten oder dem Enkeltrick oft organisierte Banden stecken, geht die Gefahr eines besonders perfiden Betrugs meist von Personen aus dem näheren Umfeld der Opfer aus. Das Muster ist immer gleich: Hinter verschlossenen Türen erschleichen sich Nachbarn, neue „Freunde“, Haushaltshilfen oder Pflegepersonal das Vertrauen älterer Menschen. Gleichzeitig säen sie Misstrauen gegenüber den vertrauten Menschen im Umfeld des Seniors. Ihr Ziel: Ersparnisse, Wertgegenstände und manchmal sogar das gesamte Vermögen der alten Menschen. Zu diesem Zweck isolieren sie ihre Opfer und bringen sie dazu, ihnen Vollmachten auszustellen.
Gefahr nicht unterschätzen
„Vollmachten sind eigentlich sinnvolle Instrumente, mit denen man Vertrauenspersonen dazu ermächtigen kann, wichtige Angelegenheiten zu regeln, wenn man dazu selbst nicht in der Lage ist“, sagt Anja Maultzsch. „Werden sie jedoch von einem Betrüger missbraucht, bergen sie große Risiken.“ So erlaubt eine Kontovollmacht den Zugriff auf ein bestimmtes Konto, eine Bankvollmacht schon auf sämtliche Giro-, Spar- und Depotkonten bei einem Kreditinstitut. Noch weitreichendere Befugnisse erteilen eine General- und eine Vorsorgevollmacht. Letztere umfasst sogar Entscheidungen über das Aufenthaltsbestimmungsrecht. Wurde sie notariell beglaubigt, darf der Vollmachtnehmer zum Beispiel auch die Wohnung des Kranken auflösen und sogar seine Immobilien verkaufen. „Die Gefahr des Betrugs ist besonders groß, wenn das Opfer kognitiv eingeschränkt ist, zum Beispiel durch eine Demenzerkrankung“, warnt Anja Maultzsch. Im Besitz der entsprechenden Vollmachten kann ein Betrüger frei schalten und walten und sich am Vermögen des Vollmachtgebers bedienen. Angehörige müssen dann meist hilflos zusehen, da eine Vollmacht erst angefochten werden kann, wenn dem Vollmachtgeber von einem Facharzt Geschäftsunfähigkeit attestiert wurde. Die Postbank Expertin rät, nur Personen zu bevollmächtigen, denen man uneingeschränkt und schon lange vertraut: „Beim Verdacht auf Missbrauch sollten Betroffene ihre Vollmacht widerrufen und sich unverzüglich an die Polizei wenden.“
Ehe ohne Ehevertrag ist die Lösung für Angsthasen
Solange es läuft, ist alles gut - aber wenn es knallt, dann richtig! Diese Aussage gilt in vielen Dingen des Lebens, und so auch für die Ehe. Wenn eine Ehe scheitert, beginnt zwischen den Ehegatten mitunter ein unschöner Rosenkrieg. Wohl dem, der mit einem Ehevertrag vorgesorgt und einvernehmlich die Trennungs- und Scheidungsfolgen geregelt hat.
In Deutschland wird fleißig geheiratet, aber auch wieder geschieden: Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes wurden im Jahr 2018 insgesamt 148.066 Ehen geschieden. Setzt man diese Zahl ins Verhältnis zu den Eheschließungen, geht durchschnittlich jede dritte Ehe in die Brüche. Wenn die Scheidung ansteht, sind Streitigkeiten vorprogrammiert und es wird teuer und kompliziert, oder?
Eine Scheidung ist nie einfach...
Eine Scheidung stellt das Leben der Betroffenen häufig völlig auf den Kopf: Sie müssen nicht nur ihren Alltag in neue Bahnen lenken, sondern auch die rechtlichen und wirtschaftlichen Auswirkungen der Ehezeit klären. "Im Rahmen einer Scheidung sind viele Einzelthemen zu regeln und die Noch-Eheleute müssen sich mit Begriffen wie Zugewinnausgleich, Versorgungsausgleich und Unterhaltsansprüchen beschäftigen" erläutert Notar Michael Uerlings, Pressesprecher der Rheinischen Notarkammer. Und das fällt den Betroffenen in einer Situation, in der ihre Gefühle verletzt worden sind und die Enttäuschung über das Scheitern der Partnerschaft groß ist, häufig nicht leicht.
...aber mit einem Ehevertrag zumindest etwas leichter
Mit einem Ehevertrag schaffen sich die Eheleute Regeln für den Ernstfall. "Gerade Frischverliebte sprechen ungerne über einen Ehevertrag, dabei kann die Diskussion über seinen Inhalt Charaktertest und erste Bestandsprobe für die Ehe sein" betont Notar Uerlings. "In bestimmten Konstellationen, wenn etwa ein Ehegatte über ein großes Vermögen verfügt oder Beamter oder Unternehmer ist, ist ein Ehevertrag fast schon zwingend, wenn man Enttäuschungen bei der Scheidung vermeiden will." Ein Ehevertrag kann jederzeit geschlossen werden, sei es vor der Eheschließung oder während der Ehe oder auch, wenn sich die Ehegatten von der Vorstellung, gemeinsam alt zu werden, schon verabschiedet haben.
Für den Ehevertrag zum Notar gehen
So bunt, wie das Leben ist, so individuell ist auch ein Ehevertrag. Und damit er wirksam ist, muss ein Ehevertrag vom Notar beurkundet werden. Vor der Beurkundung spricht der Notar die Möglichkeiten und die rechtlichen Folgen eines Ehevertrages umfassend mit den Eheleuten durch und erstellt anschließend gemeinsam mit ihnen die rechtswirksame Urkunde, um auch für den Fall einer Scheidung beruhigt in die Zukunft blicken zu können.
Elternunterhalt: Rückforderung eines Geschenks
Kinder sind verpflichtet, ihren Eltern Unterhalt zu zahlen, wenn diese bedürftig sind. Oftmals wendet sich der Sozialhilfeträger an die Kinder, um Leistungen erstattet zu bekommen. Immobilien, die die unterhaltspflichtigen Kinder selbst verschenkt haben, müssen sie aber nicht zurückfordern, sofern sich ihre Leistungsfähigkeit dadurch nicht erhöht. Darauf verweist die Arbeitsgemeinschaft Familienrecht im Deutschen Anwaltverein.
Schenkt beispielsweise ein Elternteil sein Haus den Kindern und behält sich ein Nießbrauchrecht vor, muss er die Immobilie nicht unbedingt zurückfordern, wenn er Elternunterhalt zahlen muss. Dies ergibt sich aus einer Entscheidung des Bundesgerichtshofs (BGH) vom 20. Februar 2019 (AZ: XII ZB 364/18).
Familienrecht: Rückforderungsanspruch beim Elternunterhalt
Wer eine Immobilie unentgeltlich verschenkt, kann diese zurückfordern, wenn er selbst in Not gerät. Das gilt aber auch in Fällen, in denen eine gesetzliche Unterhaltspflicht erfüllt werden muss. In dem Fall, dass der ursprüngliche Eigentümer sich ein Nießbrauchrecht vorbehalten hat, besteht die Möglichkeit, Erträge wie etwa Miete aus der Immobilie zu erzielen. Er muss deswegen aber keinen höheren Unterhalt zahlen.
Der Sozialhilfeträger kümmerte sich um die bedürftige Mutter des Sohns. Sie erhielt Sozialhilfe. Diese forderte der Träger vom Sohn im Rahmen des Elternunterhalts teilweise zurück. Der Mann ist verheiratet und bezieht Rente. Mit seiner Frau wohnt er in einer 90 Quadratmeter großen Eigentumswohnung. Diese hat er seiner Tochter übertragen und sich selbst ein lebenslanges Nießbrauchrechte vorbehalten. Das bedeutet, er kann selber Erträge aus der Wohnung ziehen. Der Sozialhilfeträger war der Meinung, der Sohn müsse die Schenkung von seiner Tochter zurückfordern, um seine Leistungsfähigkeit zu erhöhen.
BGH: Rückforderung der Schenkung nur bei eigener Not? Das Gericht sah dies anders. Der Erstattungsanspruch des Sozialhilfeträgers für die Zahlungen an die Mutter berechnet sich aus den Einkommensverhältnissen des Sohns einschließlich des Wohnvorteils. Die Rückforderung der Wohnung von der Tochter würde daher nicht die Leistungsfähigkeit des Sohns erhöhen. Deshalb müsse er das auch nicht tun, so das höchste deutsche Zivilgericht. Der Mann könne nicht verpflichtet werden, die Wohnung von seiner Tochter zurückzuverlangen.
Bundesgerichtshof am 20. Februar 2019 (AZ: XII ZB 364/18)
Zu Unrecht erhaltenes Geld ist zurückzuzahlen
Wer auf seinem Konto Geld vorfindet, auf das er keinen Anspruch hat, muss es zurückzahlen. Dies hat laut Michaela Rassat, Juristin der ERGO Rechtsschutz Leistungs-GmbH, das Amtsgericht München entschieden.
Worum ging es bei Gericht?
Ein Anrufer hatte sich bei einem 77-jährigen Rentner als Mitarbeiter einer Servicefirma von Microsoft ausgegeben und ihm weisgemacht, dass sein Computer durch Trojaner infiziert sei, die sich per Fernzugriff beseitigen ließen. Nachdem dies angeblich geschehen war, hatte der Anrufer ihm auch einen Internetschutz mit verschiedenen Laufzeiten angeboten. Der Rentner entschied sich für das Angebot mit der kürzesten Laufzeit. Dafür musste er 25 Euro überweisen. Nach Anweisung des Anrufers führte er verschiedene Schritte auf seinem PC aus. Am Ende stellte er fest, dass von seinem Konto nicht 25, sondern 4.000 Euro verschwunden waren. Das Geld kam auf dem Konto eines 82-Jährigen an, der sich weigerte, es zurückzugeben. Seine Begründung: Er sei selbst mit den angeblichen Microsoft-Mitarbeitern in Kontakt gewesen, die ihm 359,90 Euro abgenommen hätten. Ihm sei auch ein erheblicher Schaden durch das Ausspähen seiner Daten entstanden. Bei einem erneuten Anruf der Betrüger habe er ihnen mit der Polizei gedroht, woraufhin ihm diese eine Entschädigung angeboten hätten – in Höhe von 4.000 Euro.
Das Urteil
Das Münchner Amtsgericht verurteilte den 82-Jährigen dazu, das Geld zurückzuzahlen: Der 77-Jährige habe nur 25 Euro als Kaufpreis für einen Internetschutz überweisen wollen. Der 82-Jährige habe ihm diesen aber nicht verkauft und er habe auch sonst keinen Anspruch auf die 4.000 Euro. Was der 82-Jährige mit Dritten besprochen habe, die ebenfalls keinen Anspruch auf diesen Betrag hätten, sei nicht von Belang. „Hier zählte für das Gericht nur die Beziehung zwischen dem Absender und dem Empfänger des Geldes“, erklärt Michaela Rassat. Und da der Empfänger gegenüber dem Absender keinen Anspruch auf die Zahlung hatte, musste er das Geld zurückgeben – und blieb auf dem eigenen Schaden sitzen.
Was bedeutet das für Mieter?
Derzeit ist ein deutlicher Anstieg von Betrugsdelikten gegen Rentner und auch allgemein von Internetbetrügereien zu beobachten. Die Firma Microsoft ruft niemanden zu Hause an, um dessen PC zu warten. Auch Aufforderungen beim Surfen im Internet, einen angeblichen Support von Microsoft anzurufen, sind gefälscht. „Wer Fremden anhand von deren Anweisungen einen Fernzugriff auf den eigenen PC einräumt, hilft sehr wahrscheinlich bei der Installation von Programmen, die Bank- oder Kreditkartendaten ausspähen. Oder die Täter installieren Programme, die den Computer sperren, um dann Geld für dessen Freigabe zu fordern. Internetnutzer sollten sich daher nicht auf dubiose Wartungsangebote einlassen – auch wenn sie überzeugend klingen“, warnt die ERGO Rechtsexpertin.
Amtsgericht München, Urteil vom 16. Januar 2019, Az. 122 C 19127/18
Urlaubsfotos posten: Warum Vorsicht geboten ist!
Eine Frage die viele private "Schnappschussjäger" betrifft:
Auf meinem Facebook-Account poste ich regelmäßig Bilder – vor allem während und nach Urlauben zeige ich gerne neue, tolle Motive. Aber was muss ich dabei eigentlich beachten?
Michaela Rassat, Juristin der D.A.S. Rechtsschutz Leistungs-GmbH:
Für private Posts gilt: Personen haben ein „Recht am eigenen Bild“. Sind andere Personen, beispielsweise Urlaubsbekanntschaften, auf einer Aufnahme zu erkennen, muss immer deren Einwilligung für die jeweilige Nutzung des Bildes vorliegen. Ausnahmen gelten, wenn die Personen nur unwesentliches „Beiwerk“ des Hauptmotivs sind oder in einer Menschenmenge untergehen. Ein Verstoß gegen das Recht am eigenen Bild ist eine Straftat. Auch Fotos von Gebäuden oder Denkmälern können Probleme bereiten, denn Künstler und Architekten haben ein Urheberrecht an ihrem Werk. Die sogenannte Panoramafreiheit erlaubt es jedoch, Gebäude und Denkmäler an öffentlichen Straßen und Plätzen von außen zu fotografieren und die Fotos zu posten. Voraussetzung: Der Fotograf steht beim Fotografieren auf einer öffentlichen Straße und benutzt kein Hilfsmittel wie etwa eine Leiter. Doch auch hier gibt es Ausnahmen: Zum Beispiel gilt die nächtliche Beleuchtung des Pariser Eiffelturms als Kunstwerk. Bilder davon sind lizenzpflichtig und dürfen ohne Erlaubnis nicht veröffentlicht werden. Wer in einem Museum oder auf einem Veranstaltungsgelände fotografiert, muss etwaige Verbote durch den Hausherrn respektieren. Wichtig zu wissen: Facebook räumt sich selbst in seinen Geschäftsbedingungen an jedem geposteten Foto nicht exklusive Nutzungsrechte ein. Diese Rechte gelten weltweit und umfassen sogar die Erteilung von Unterlizenzen. Daher empfiehlt es sich, vorab genau zu überlegen, was online gehen soll.
Patientenverfügung spätestens alle zwei Jahre überprüfen
Auch wenn die Beschäftigung mit Themen wie Krankheit und Tod vielen unangenehm ist - eine Patientenverfügung sollte jeder frühzeitig ausfüllen. "Es geht nicht nur darum, lebenserhaltende Maßnahmen auszuschließen. Es geht auch darum, den Angehörigen nicht die Entscheidung aufzubürden", sagt Birgit Carl vom Verein "Augsburger Hospiz- und Palliativversorgung" im Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber". Sie empfiehlt, die Patientenverfügung spätestens alle zwei Jahre zu überprüfen. Sind die Wünsche noch aktuell? Hat sich an meiner Situation etwas geändert?
Mit "gesundheitlicher Vorausplanung" übersetzt die Expertin den englischen Fachbegriff "Advance Care Planning". Im Prinzip geht es darum, dass vor allem Kranke sich immer wieder mit ihrer Diagnose beschäftigen, alle Behandlungsmöglichkeiten kennen und verstehen, mit ihren Angehörigen und den Ärzten diskutieren und ihren Willen schriftlich festlegen und Stellvertreter benennen. Wichtig dabei ist laut Carl: "Die Patientenverfügung und die Vorsorgevollmacht dürfen nicht im Safe eingesperrt sein. Sie sollten besser im Regal liegen, da kommt im Notfall jeder ran."
Mit wem die Deutschen am liebsten streiten
68 Prozent der Deutschen hatten schon mal einen Rechtsstreit. Meistens geht es um die Mietwohnung, einen Unfall oder Ärger mit Behörden. Das zeigt eine aktuelle YouGov-Umfrage im Auftrag der DEVK. Wer rechtsschutzversichert ist, erspart sich ein beträchtliches Kostenrisiko.
Pragmatisch und kompromissbereit: So schätzen sich 61 Prozent der Bundesbürger ein. Die Studie belegt, dass die Mehrheit der Deutschen nur im Notfall rechtliche Schritte einleiten will. 25 Prozent geben sogar an, dass sie einem Rechtsstreit aus dem Weg gehen und versuchen, sich gütlich zu einigen. Nur 9 Prozent bestehen auf ihrem Recht und setzen es durch. Tatsache ist: Seinen Rechtsanspruch durchzusetzen, ist in den letzten Jahren immer teurer geworden. Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) hat von 2012 bis 2016 jährlich mehr als 1,4 Millionen Rechtsschutzfälle untersucht. In diesem Zeitraum sind die durchschnittlichen Ausgaben für Anwälte und Gerichte um 19 Prozent gestiegen.
Direkter Kontakt zum Anwalt des Vertrauens
Nur 32 Prozent der Deutschen hatten laut YouGov-Umfrage noch nie einen Rechtsstreit. Alle anderen haben damit bereits Erfahrung - bei den über 45-Jährigen sind es sogar fast drei Viertel der 2.043 Befragten. Insgesamt hatten dabei 34 Prozent persönlich Kontakt mit einem Rechtsanwalt, 14 Prozent telefonisch und 6 Prozent per E-Mail. Ein Viertel kannte den angesprochenen Anwalt bereits, fast ebenso viele haben ihn sich von Familie oder Freunden empfehlen lassen. 17 Prozent der Kontakte haben Rechtsschutzversicherer vermittelt. 15 Prozent sind über eigene Internetrecherche an ihren Anwalt gekommen, 12 Prozent haben ihn wegen der Nähe zum Wohnort ausgewählt.
Streit um die Mietwohnung weit verbreitet
Stein des Anstoßes sind vor allem Mietverhältnisse (13 Prozent), Unfälle (12 Prozent) und Schwierigkeiten mit Behörden (12 Prozent). Die Deutschen streiten auch häufig mit Arbeitgebern (10 Prozent), Familienmitgliedern (9 Prozent), Käufern bzw. Verkäufern (8 Prozent) sowie Nachbarn (7 Prozent).
Trend: Mediation ist gefragt
Dabei sind 90 Prozent durchaus bereit, sich gütlich zu einigen. 40 Prozent der Deutschen würden bei einem Rechtsstreit eine Mediation in Betracht ziehen, weitere 50 Prozent vielleicht. Doch auch eine Mediation kostet Geld. Versicherte der DEVK können seit mehr als zehn Jahren Mediation als abrechenbare Leistung in Anspruch nehmen. Mehrere tausend Rechtsschutz-Kunden der DEVK machen davon pro Jahr Gebrauch. Wer eine Mediation wünscht, bekommt dafür einen Partner empfohlen. Alle DEVK-Mediatoren sind gleichzeitig auch Anwälte. Die Erfahrung zeigt: Versicherte, die die Mediation in Anspruch nehmen, sind damit sehr zufrieden.
Ehegattentestament: Unwirksam bei Scheidung?
Ein gemeinschaftliches Testament von Ehegatten verliert seine Gültigkeit, wenn ein Ehepartner die Scheidung einreicht und der andere zustimmt. Die Ehepartner können dann für sich selbst jeweils neue Testamente aufsetzen. Auch ein Mediationsverfahren mit dem Ziel einer Versöhnung ändert nichts an der Unwirksamkeit des gemeinsamen Testaments. Dies hat laut D.A.S. Rechtsschutz Leistungs-GmbH das Oberlandesgericht Oldenburg entschieden. OLG Oldenburg, Az. 3 W 71/18
Hintergrundinformation: Viele Ehepaare setzen ein gemeinschaftliches Testament auf. Dafür gelten besondere Regeln. Stirbt zum Beispiel ein Ehepartner, kann der andere das Testament nicht ohne Weiteres widerrufen oder durch ein neues ersetzen. Eine Scheidung allerdings macht das gemeinschaftliche Testament unwirksam.
Der Fall: Ein Ehepaar hatte ein gemeinschaftliches Testament aufgesetzt. Beide hatten sich darin gegenseitig als Erben eingesetzt. Ein Jahr später kam es zur Trennung. Der Ehemann setzte nun ein neues Testament auf und machte seine Adoptivtochter zur Alleinerbin. Dann reichte die Ehefrau die Scheidung ein, der der Ehemann vor Gericht zustimmte. Allerdings wollten beide noch ein Mediationsverfahren durchlaufen, um herauszufinden, ob sich die Ehe vielleicht retten ließe. Der Mann verstarb jedoch. Die Ehefrau und die Adoptivtochter waren nun beide der Meinung, seine Alleinerben zu sein. Es kam zum Prozess.
Das Urteil: Das Oberlandesgericht Oldenburg erklärte nach Informationen des D.A.S. Leistungsservice die Adoptivtochter zur Alleinerbin. Nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch verliere ein gemeinschaftliches Testament seine Wirksamkeit, wenn die Ehe geschieden sei oder die Voraussetzungen für eine Scheidung vorlägen, also der Erblasser entweder die Scheidung beantragt oder ihr zugestimmt habe. Diese Situation liege hier vor. Die Eheleute hätten bereits drei Jahre lang getrennt gelebt. Der Wunsch nach einem Mediationsverfahren reiche nicht aus, um anzunehmen, dass beide die Ehe fortsetzen wollten. Zwar sehe das Gesetz eine Ausnahme vor: Ein gemeinsames Testament bleibe auch bei einer Scheidung gültig, wenn beide Ehepartner dies von Anfang an so bestimmt hätten. Dies sei hier aber nicht der Fall gewesen. Die Ehefrau ging daher leer aus.Oberlandesgericht Oldenburg, Beschluss vom 26. September 2018, Az. 3 W 71/18
Kosten eines Rechtsstreits als Werbungskosten absetzen
Es gibt viele Situationen, in denen es sich lohnt einen Anwalt aufzusuchen. Wer keinen Rechtschutz hat oder wenn der nicht zahlt, dann sind die Gebühren selbst zu stemmen. Geht es in Folge vor ein Gericht, dann können mitunter höhere Kosten das Haushaltsbudget belasten. "Kosten für Zivilprozesse werden unter bestimmten Voraussetzungen vom Finanzamt jedoch anerkannt", erklärt Robert Dottl, Vorstandsvorsitzender der Lohnsteuerhilfe Bayern e.V. (Lohi). Und zahlt der Rechtsschutz doch, so kann zumindest die Selbstbeteiligung, die der Steuerpflichtige zu tragen hat, in der Steuererklärung geltend gemacht werden.
Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, in denen Prozesskosten als Werbungskosten geltend gemacht werden können. Werbungskosten im Sinne des Einkommensteuergesetzes sind Aufwendungen, die getätigt werden, um Einnahmen zu erzielen, abzusichern oder zu erhalten. Hängt ein Streitfall also unmittelbar mit einer Einkunftsart zusammen, können die Kosten dafür in der Einkommensteuererklärung abgesetzt werden. "Die Höhe der Einnahmen spielt für das Finanzamt dabei keine Rolle, ebenso wenig ob ein Verfahren erfolgreich war oder nicht", so Robert Dottl. Auch ist es steuerrechtlich egal, ob man Kläger oder Beklagter ist. Zu den Prozesskosten zählen die Kosten für das Gerichtsverfahren, Sachverständige und Anwälte.
Streit mit dem Arbeitgeber
Arbeitsrechtsfälle sind in jedem Fall absetzbar, wenn der Arbeitslohn oder das Arbeitsverhältnis, zum Beispiel bei einer Kündigungsschutzklage, Gegenstand des Streits sind. Selbst wenn es sich um ein berufliches Disziplinarverfahren handelt, geht der Abzug. Wenn bei einem Strafverfahren, bei dem nicht mit Vorsatz gehandelt wurde, ein rein berufliches Handeln zugrunde liegt, erkennt der Fiskus die Kosten ebenso an. Passiert auf dem Weg zur Arbeit oder von der Arbeit nach Hause ein Wegeunfall und wird infolge dessen um die Kostenübernahme gestritten, sind die Kosten des Rechtsstreits als Werbungskosten abzugsfähig, da der Arbeitsweg mit der Arbeit in Zusammenhang steht.
Streit mit dem Mieter
Bei Streitigkeiten aus dem Mietrecht, wie Mietrückstande, Mietminderung, Mängel am Mietobjekt, Schönheitsreparaturen, Renovierung, Kündigung oder Eigenbedarf, kann üblicherweise nur der Vermieter oder Verpächter die Kosten absetzen, da er derjenige ist, der mit der Vermietung Einkünfte erzielt.
Streit wegen der Rente
Betrifft die Auseinandersetzung Einkünfte aus der gesetzlichen oder einer privaten Rentenversicherung, Betriebsrenten oder Pensionen, sind die Prozesskosten steuerlich abzugsfähig. Sie werden jeweils bei der Einkunftsart berücksichtigt, bei der sie entstanden sind. Wird die Zahlung einer gesetzlichen Rente eingeklagt, sind die Prozesskosten bei den sonstigen Einkünften abziehbar. Geht es dagegen um eine Betriebsrente oder Pension werden sie bei den nichtselbstständigen Einkünften berücksichtigt.
Nicht absetzbare Streitigkeiten
Aufwendungen für Streitigkeiten aufgrund einer Erbschaft werden als Werbungskosten nicht anerkannt, auch wenn das Erbe eine Einkunftsquelle beinhaltet. Diese Prozesskosten werden der privaten Lebensführung zugeordnet, da es primär um den Erwerb oder die Aufteilung des Erbes und geht. Auch die Kosten einer Scheidung werden der Privatsphäre zugeordnet.
Streit mit dem Finanzamt
Geht es vor ein Finanzgericht, können die Prozesskosten ebenfalls bei derjenigen Einkunftsart, um die gestritten wird als Werbungskosten abgezogen werden. Wird mit der Klage selbst ein Abzug von Werbungskosten anvisiert, dann sind die Aufwendungen abziehbar. Wird jedoch zum Beispiel um den Abzug von Sonderausgaben gestritten ist kein Abzug erlaubt.
Fallen Prozesskosten an, wird die Werbungskostenpauschale von 1.000 Euro leicht überschritten. Darüber hinaus rechnet sich jeder Euro, denn er mindert entsprechend dem persönlichen Steuersatz die Steuerlast. In Fällen, bei denen die Prozesskosten vom Fiskus anerkannt werden, sind bei der Einkommensteuererklärung die Fahrtkosten mit 0,30 Euro je gefahrenen Kilometer zum Anwalt oder Gericht nicht zu vergessen.
Jede Vollmacht kann man widerrufen / Ob Vorsorgevollmacht oder Betreuungsverfügung - niemand legt sich unwiderruflich fest
Auf eine Vorsorgevollmacht oder Betreuungsverfügung sollte niemand verzichten, weil er fürchtet, an die einmal getroffene Entscheidung ewig gebunden zu sein. Falls man sich etwa mit einer Vertrauensperson zerstreitet oder seine Meinung ändert, ist das kein Problem. "Man kann alle Verfügungen jederzeit ohne Angabe von Gründen ändern oder widerrufen", sagt Dr. Hubertus Rohlfing, Notar und Fachanwalt von der Arbeitsgemeinschaft Erbrecht des Deutschen Anwaltsvereins, im Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber". Seiner Erfahrung nach gehen die meisten Menschen mit Vollmachten aber sehr verantwortungsbewusst um: "Missbrauch ist selten, und wenn, geht es meist um sehr viel Geld."
Wie Testamente zuverlässig und kostengünstig aufgefunden werden
Erst seit 2012 gibt es ein zentrales gesetzliches Register für Testamente in Deutschland. Das von der Bundesnotarkammer geführte Zentrale Testamentsregister verzeichnete im dritten Jahr seines Bestehens bereits 7,7 Mio. Urkunden und bietet jedermann die Möglichkeit sein Testament kostengünstig registrieren zu lassen. Aktuell werden die Testamentsverzeichnisse der Standesämter in Nordrhein-Westfalen in das Register überführt; ab Frühjahr 2015 folgt Rheinland-Pfalz. Bis Ende 2016 wird der Verwahrort von 20 Millionen Urkunden für Gerichte und Notare zentral und zuverlässig abrufbar sein. Selbst das wohlüberlegteste Testament zählt letztlich nichts, wenn es nach dem Tod nicht dem Nachlassgericht zur Eröffnung übergeben wird. Bürger, die sich mit der Abfassung ihres letzten Willens beschäftigten, stoßen zwangsläufig auf das Problem, wie sie sicherstellen können, dass ihr letzter Wille auch aufgefunden und befolgt wird. "Besonders häufig machen sich Alleinstehende darüber Sorgen", berichtet Dr. Steffen Breßler, Geschäftsführer der Notarkammer Koblenz, aus der Beratungspraxis. Aber auch Ehegatten fühlen sich nach seiner Erfahrung oft unsicher, wenn sie beispielsweise an einen gemeinsamen Autounfall denken. Dr. Breßler rät, Testamente im 2012 gesetzlich eingeführten Zentralen Testamentsregister vermerken zu lassen. "Zahlreiche Bürger meinen zu Unrecht, es kämen hohe Kosten auf sie zu. Tatsächlich ist ein professionell beratenes und beurkundetes Testament regelmäßig günstiger als eine Autoinspektion", weiß Dr. Breßler. Die Gebühr für die Registrierung beim Zentralen Testamentsregister beträgt einmalig 18 Euro und die Verwahrung durch das Amtsgericht kostet einmalig pauschal 75 Euro. Die Kosten für ein notarielles Einzeltestament sind vermögensabhängig. Bei einem Nachlasswert von 50.000,- Euro liegt die Gebühr für die Tätigkeiten des Notars beispielsweise bei 165,- Euro bzw. bei 354,- Euro im Fall eines Nachlasswerts von 150.000,- Euro. Das notarielle Testament empfiehlt sich laut Dr. Breßler aber nicht nur wegen der fachkundigen Beratung bei der Abfassung, sondern auch, weil damit die hohen Kosten für einen Erbschein gespart werden können. Die Bundesnotarkammer hat eine gebührenfreie Informationshotline unter der Rufnummer 0800-3550700 für Anfragen zum Zentralen Testamentsregister eingerichtet. Interessierte Bürger erhalten hier sowie im Internet unter www.testamentsregister.de Antworten auf Fragen zu dem gesetzlichen Register.
Wilde Ehe - ein rechtsfreier Raum?
Nicht eheliche Lebensgemeinschaften sind schon lange in der Gesellschaft angekommen. Doch wenn es um Fragen zu Unterhalt, Altersvorsorge, gemeinsamen Vermögenswerten oder Schulden geht, gilt im Gegensatz zur Ehe kein spezifisches rechtliches Regelsystem. Wie sich nicht eheliche Partner dennoch vor den Folgen von Trennung oder Todesfall schützen, kann ein Notar klären. Trennen sich die ehemaligen Partner auf Lebenszeit, so bricht in aller Regel Streit um Vermögenswerte aus. "Während die Gerichte früher den nichtehelichen Lebenspartnern einen Ausgleich nach beendeter Lebensgemeinschaft grundsätzlich verwehrten, kommen nun Ausgleichsansprüche in Betracht.
Zumindest dann, wenn der eine Partner wirtschaftlich wertvolle Leistungen, wie etwa Geld oder Arbeitsleistungen, für den anderen Partner erbracht hat, diese jedoch keinen Niederschlag in der rechtlichen Beteiligung des gemeinsamen Vermögens gefunden haben," erklärt Bernd v. Schwander, Geschäftsführer der Hamburgischen Notarkammer und nennt als typisches Beispiel ein gemeinsames Darlehen für den Hauskauf, bei dem aber nur ein Partner im Grundbuch steht. Für den Fall der Trennung schafft nur ein Vertrag zwischen den ehemaligen Partnern Rechtssicherheit. Dieser sollte am Besten schon vor einer Trennung von den Partnern geschlossen werden und besonders kritische Punkte wie die Aufteilung des gemeinsamen Vermögens und der gemeinsamen Schulden verbindlich und abschließend regeln. Während ein solcher Vertrag grundsätzlich privatschriftlich geschlossen werden kann, ist die Einschaltung eines Notars immer dann erforderlich, wenn Immobilienvermögen zu teilen ist. Ebenfalls ist der Gang zum Notar erforderlich, wenn die Partner für sich bzw. für ihre gemeinsamen Kinder wirksame und vollstreckbare Unterhaltstitel schaffen wollen. Ein weiterer Vorteil bei Beziehungsende: Ein Vertrag erspart den Partnern ein zeitraubendes, kostenintensives und emotional belastendes Gerichtsverfahren.
Auch für den Fall des Endes der nichtehelichen Lebenspartnerschaft durch Tod lässt sich vertraglich vorsorgen. Schließt man den notwendigen Vertrag vor einem Notar, berücksichtigt dieser mit den Partnern auch die erbrechtlichen Fragestellungen. "Trotz der Verbreitung der Form der nichtehelichen Lebensgemeinschaft hat der Gesetzgeber diese Entwicklungen im Erbrecht noch keinen Niederschlag finden lassen. Nichteheliche Lebenspartner werden weiter wie außenstehende Fremde behandelt. Das ändert sich auch dann nicht, wenn die nichtehelichen Lebenspartner gemeinsame Kinder haben. So kann unter Umständen der entfernte Verwandte des verstorbenen Partners sein gesetzliches Erbrecht geltend machen, während der eigentliche Lebenspartner im Erbfall leer ausgeht" erklärt v. Schwander weiter. Gerade hier und für alle anderen wahrscheinlichen Streitfragen zwischen den Partnern empfiehlt es sich, die fast immer als nicht interessengerecht empfundenen gesetzlichen Regelungen mit Hilfe einer individuellen Beratung durch den Notar vertraglich und testamentarisch zu modifizieren.
Mahngebühren - Drei Viertel der Unternehmen verlangen zu viel
Eine Umfrage des ZDF-Magazins "WISO" unter 40 großen Unternehmen aus verschiedenen Branchen zeigt, dass sich drei Viertel von ihnen nicht an die gängige OLG-Rechtsprechung zu Mahngebühren halten. Für Mahnschreiben werden danach bis zu 25 Euro verlangt. Gerichtlich anerkannt sind maximal 2,50 Euro.Die Rechtslage: Unternehmen dürfen nur die Kosten einer Mahnung vom Verbraucher verlangen, die auch tatsächlich entstanden sind. Das sind allerdings nur die Ausgaben für Papier, Druck und Porto. Allgemeine Personal- und Verwaltungskosten dürfen dagegen nicht berechnet werden. Viele Gerichte haben sich bereits mit der Höhe solcher Mahnkosten befasst und bisher für ein einzelnes Mahnschreiben lediglich Gebühren bis 2,50 Euro anerkannt.
Was tun, wenn man erbt und der Nachlass vor allem Schulden sind?
Leider kann man nicht nur wertvolle Dinge erben, sondern auch Schulden. “Wenn man absolut sicher ist, dass der Nachlass überschuldet ist, sollte man das Erbe ausschlagen”, rät Dr. Hubertus Rohlfing, Fachanwalt für Erbrecht in Hamm, im Apothekenmagazin “Senioren Ratgeber”. Die Erklärung muss allerdings innerhalb von sechs Wochen beim Amtsgericht vorliegen. Doch Vorsicht: Dies rückgängig zu machen, ist nur selten möglich. Bei Zweifeln oder wenn Unklarheit über die Vermögensverhältnisse besteht, kommt man um fachanwaltliche Beratung kaum herum. Je nach Sachlage kann eine “Dürftigkeitseinrede” gegenüber Gläubigern nötig sein, eine “Nachlassinsolvenz” oder eine “Nachlassverwaltung” beim Amtsgericht. Eine verschleppte Nachlassinsolvenz ist sogar strafbewehrt. Erben kann also ziemlich gefährlich sein.
Zentrales Testamentsregister ist Deutschen kaum bekannt
Das am 1. Januar 2012 neu eingeführte Zentrale Testamentsregister in Berlin ist in Deutschland kaum bekannt. So geben exakt drei Viertel der Wohnbevölkerung ab 16 Jahren in einer Erhebung der Postbank an, „gar nicht“ zu wissen, wie die neue Form der Testamentshinterlegung funktioniert. Nur vier von hundert Befragten kennen die Funktionsweise „ziemlich genau“, 17 Prozent glauben, dies „ungefähr“ zu wissen und vier Prozent der Befragten machten dazu keine Angaben. Seit Anfang 2012 führt die Bundesnotarkammer in Berlin das Register, damit Nachlassgerichte in Sterbefällen schneller Entscheidungen treffen können. Alle amtlich verwahrten Urkunden, die erbfolgerelevante Sachverhalte regeln, sind in Berlin zentral registriert. Die Registrierung erfolgt automatisch durch Notare, die Testamente beurkunden. Bei eigenhändigen Testamenten, die in amtliche Verwahrung gegeben werden, müssen die Amtsgerichte das Zentrale Testamentsregister informieren.
Auffallend ist in der Postbank-Erhebung, dass die Kenntnis der neuen Einrichtung stark mit Wohnort und Beruf der Befragten zusammenhängen. So stehen die Berliner mit sieben Prozent „ziemlich genauer“ Kenntnis bundesweit auf Platz 1. Das Schlusslicht bilden die Bayern. Von ihnen sagen nur drei Prozent, dass sie das Zentrale Testamentsregister „ziemlich genau“ kennen. Ebenso gibt es Unterschiede zwischen den Berufsgruppen: Während fast jeder zehnte Beamte das Zentrale Testamentsregister „ziemlich genau“ kennt, sind es bei den Angestellten nur vier Prozent.
Die Bundesnotarkammer hat eine gebührenfreie Informationshotline unter der Rufnummer 0800-3550700 für Anfragen an das Zentrale Testamentsregister eingerichtet. Interessenten erfahren hier unter anderem, wie auch eigenhändig gefertigte Testamente zentral registriert werden können. Denn laut Postbank-Erhebung hat jeder vierte Deutsche, der ein Testament hat, dies ohne Unterstützung durch einen Notar oder Anwalt gefertigt.
Ausbildungsunterhalt: Wann Eltern nicht für Ausbildung oder Studium zahlen müssen
Eltern müssen zwar für ihre Kinder eine Ausbildung oder das Studium finanzieren – aber nicht in jedem Fall und vor allem nicht ewig. Lassen sich die Kinder zu viel Zeit oder merken sie nach der ersten Ausbildung, dass sie doch lieber eine Ausbildung oder ein Studium in einer anderen Branche machen möchten, müssen Eltern in der Regel nicht mehr für den Unterhalt des Kindes aufkommen, so Finanztest in der aktuellen Mai-Ausgabe.
Ein 27-Jähriger, der nach der Schule erst ein Jahr jobbte, dann Zivildienst machte, anschließend noch ein Jahr jobbte und dann das Abitur nachholte – dem müssen die Eltern das Studium nicht mehr finanzieren. Aus dem Ausbildungsunterhalt raus sind auch Eltern, deren Kinder einige Jahre nach einer finanzierten ersten Ausbildung noch studieren wollen. Denn wenn die Kinder finanziell schon auf eigenen Beinen standen, müssen sie das spätere Studium selber finanzieren.
In der Regel müssen Eltern die erste Ausbildung oder bei Abiturienten das Studium finanzieren. Schließen Kinder nach dem Bachelor-Abschluss zügig ein Master-Studium an, müssen Eltern auch für das Master-Studium aufkommen. Wie tief Eltern in die Tasche greifen müssen, hängt von ihrem Einkommen und ihrer Lebenssituation ab. Als Richtwert gelten 670 Euro monatlich für Studenten, die nicht bei den Eltern wohnen. Doch Vater und Mutter steht ein Mindestselbstbehalt von jeweils 1150 Euro zu. Dazu kommen Aufschläge für berufsbedingte Kosten wie etwa Fahrten zur Arbeit, für Altersvorsorge, Kreditraten und Kosten für weitere Kinder, so dass der Selbstbehalt um mehrere hundert Euro höher liegen kann.
Eltern haben aber nicht nur eine Unterhaltsverpflichtung, sie können auch von ihren Kindern detaillierte Informationen darüber verlangen, welche Kurse, welche Prüfungen, welche Praktika sie machen. Eine Sozialpädagogik-Studentin im neunten Semester hatte dazu keine Lust – mit Folgen: Das Oberlandesgericht strich ihr den Unterhalt.